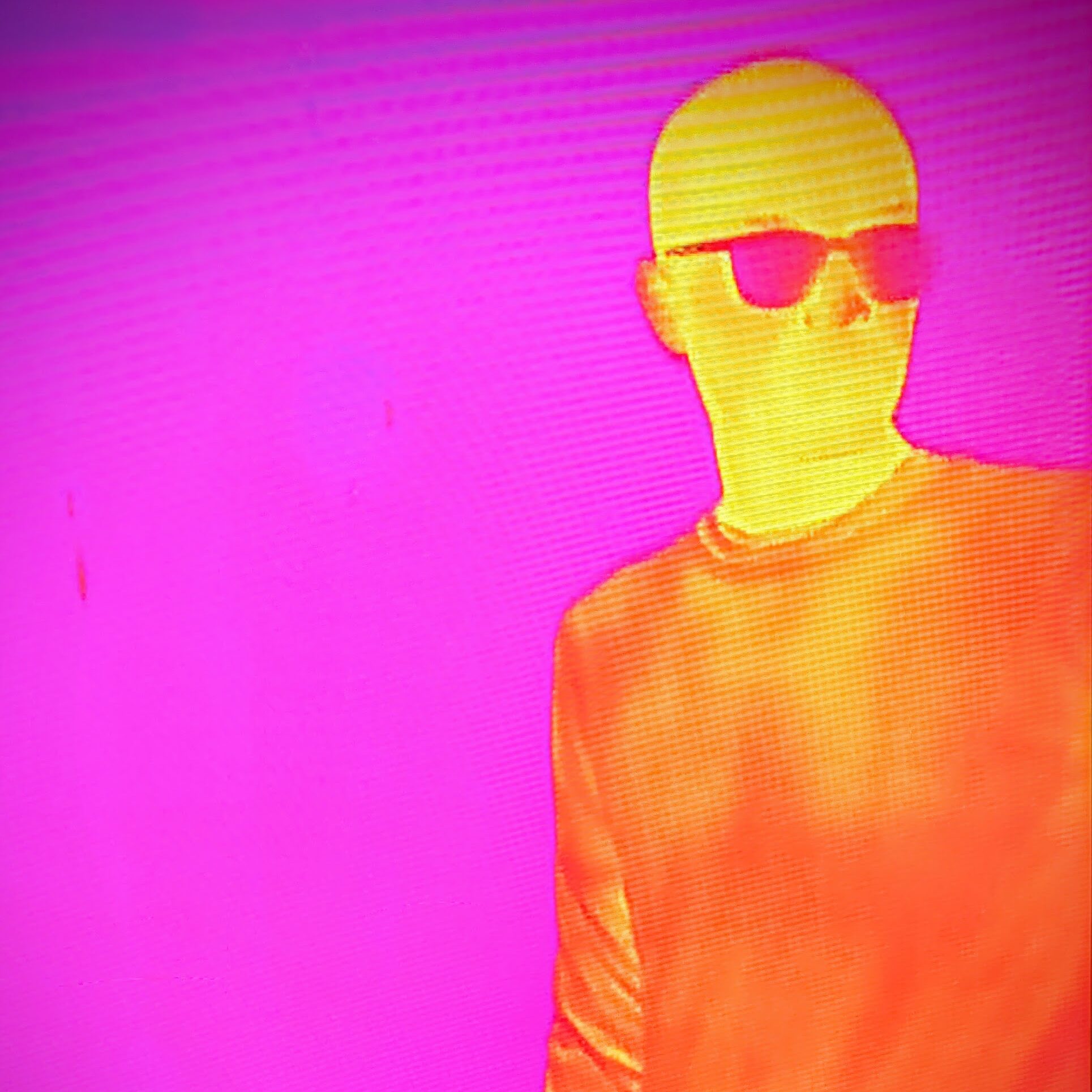Bewegen sie sich ins Bistro. Trinken Sie dort einen Kaffee und genießen sie eine selbstgedrehte Zigarette in der Sonne. Gehen sie direkt dorthin, nehmen sie keinen Umweg in Kauf. Vielleicht können sie später kreativ sein.
-
-
Peter Müller am vergangenen Sonntag in einem Saabrücker Theater:
- Es kann ein Spannungsverhältnis entstehen zwischen subjektiver Wahrheit und Mehrheit. Politik hat deshalb das Ziel der Versöhnung von Wahrheit und Mehrheit. Um dies zu erreichen, braucht sie Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit wird auch durch theatralische Darstellung erreicht. Sind Politiker deshalb Schauspieler? Natürlich sind sie es, und diese Feststellung beinhaltet kein Werturteil.
Damit wir wissen, warum es hier geht.
- Die Tatsache, dass Politiker Schauspieler sind, kann sowohl positiv als auch negativ sein. Sie ist positiv, wenn es dem Politiker wie einem Schauspieler darum geht, Kontakt aufzunehmen zu seinem Publikum, den Wählerinnen und Wählern, um deren Wünsche zu erkennen und sich mit ihnen auseinander zu setzen. Politik hat die Aufgabe, wie Martin Luther es gesagt hat, dem „Volk aufs Maul“ zu schauen. Negativ wird diese Forderung, sich auf das Publikum einzulassen, in dem Moment, in dem der Politiker schauspielerische Elemente einsetzt, um von seinen Inhalten abzulenken. Negativ ist die schauspielerische Tätigkeit des Politikers, wenn er jedem zum Gefallen sein will, ohne deutlich zu machen, wofür er wirklich einsteht.
Dann, Herr Müller, haben wir uns am vergangenen Freitag tatsächlich an schauspielerischen Talenten erfreuen können. Es handelt sich also um negatives Schauspiel, nicht um legitimes.
- Politiker dürfen nicht selbstgerecht und unnahbar werden. Sie müssen aber auch die Tendenz zum zynischen Populismus unterdrücken, die sehr schnell entstehen kann und die möglicherweise kurzfristig zu Wahlerfolgen führt.
In der Tat. Die Reaktion auf zynischen Populismus ist ein zynisches Populus sein.
- Ist Politik also Theater? Ja, Politik ist Theater. Aber auch dieser Umstand ist weder gut noch schlecht. So lange das politische Theater einen Beitrag dazu leistet, Aufmerksamkeit zu erreichen für die vertretenen Inhalte, ist das politische Theater gut. Es ist schlecht, wenn dadurch von den Inhalten abgelenkt werden soll. Ohne Theater kann in dieser Gesellschaft keine erfolgreiche Politik gestalten werden. Wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft, und diese Kommunikationsgesellschaft folgt klaren Kategorien. Ich will sie zitieren, so wie sie der Kommunikationsphilosoph Vilem Flusser definiert hat. Erste Kategorie, erster Hauptsatz: „Was nicht kommuniziert wird, ist nicht, und je mehr es kommuniziert wird, desto mehr ist es.“ Zweiter Hauptsatz: „Alles, was kommuniziert wird, ist etwas wert, und je mehr es kommuniziert wird, desto wertvoller ist es.“
Flusser hätte ich hier nicht erwartet. Ich fürchte, er wird da vor einen Karren gespannt… Ich prüfe mal, in welchem Zusammenhang das Zitat zu verorten ist.
-
-
Einen Eklat nennen die Meisten heute das, was bis vergangenen Freitag noch Zuwanderungsdebatte hieß. Dieser Eklat wird, wenn der Bundespräsident das Gesetz billigt und damit für verfassungsrechtlich einwandfrei erklärt, ein Makel sein, der diesem Gesetz in Zukunft stets anhaften wird. Ganz ähnlich wie der einst durchgeboxten Steuerreform, an der einige Bundesländer ganz gut verdient haben.
Wir haben Theater gesehen. Die Experten werden sich nun einige Zeit streiten, ob es sich hier um legitimes Theater oder eher um Schmierentheater handelt. Schlecht inszeniertes Theater dürfte wohl das kleinste gemeinsame Attribut sein. Wenn es tatsächlich irgendein absurdes Theaters ist, dann hat dies den Vorteil, daß man den von ihren zornigen Dialogen völlig erschöpften, aber vermutlich nur kurz aus der Puste geratenden Schauspielern zusehen kann, wie sie sich und ihre Politik endgültig demaskieren.Da bietet sich nun erstmalig die Chance, Gesetz werden zu lassen, was seit 1954, als sich die ersten Italiener tränenreich von Heimat und Familie verabschiedeten, Realität ist. Jedoch heißt diese Realität nicht Zuwanderung, sondern Anwerbestoppausnahmeregelung und sollte daher auf Empfehlung Rita Süssmuths per Gesetz nicht nur einen neuen Namen erhalten und Realität werden lassen, was jahrzehntelange Praxis ist, sondern auch eine moderne, offene Republik dokumentieren. Modern und offen freilich zunächst für jene, die Deutschland einen Dienst erbringen. Der formale Status, der Flüchtlingen garantiert, nach den Genfer Konventionen behandelt zu werden, wurde erst auf Grund kirchlichen Drucks in die Zeilen des Gesetzes aufgenommen.
Trotzdem ist die Neuregelung der Anwerbestoppausnahmeregelung sinnvoll. Sie wird von großen Teilen der Bevölkerung begrüßt. Wirtschaft, Sozialverbände, Gewerkschaften und die Kirchen zeigen sich nach X Änderungen des Gesetzes zufrieden. Auch die Parteien sind sich grundsätzlich einig. Hatte Roland Koch noch vor Jahren das Thema per Volksentscheid von der Tagesordnung gestrichen, so zog der Kanzler die Green Card aus der Tasche, um einer schwächelnden Schlüsselbranche schnell und punktgenau gut gebildete Arbeitskräfte zuzuführen. Ich musste zwar immer grinsen, wenn ich durchs Schaufenster den Inder sah, der neu-startend und kellnernd im Internetcafe arbeitete, es machte aber eine Debatte möglich, in der die CDU sogar noch die progressiveren Forderungen stellte.Mittlerweile, es dauert mitunter Monate, wenn nicht Jahre, bis wichtige Reformen Realität werden, ist die Entscheidung um die Zuwanderung ins Wahljahr vertagt worden. Da gelten andere Prioritäten, werden den Politikern andere Fähigkeiten abverlangt als die zum Konsens und der Vernunft. Im Wahljahr haben die Kanzlerberater das Sagen. Und die Kanzlerkandidatenberater. Ihre Medienexperten, Wahlkampfmanager. Wo immer Politiker auftauchen sehen sie sich einem Wald aus Kameras und Mikrofonangeln ausgesetzt. Demografen und Empiriker sind die Seismographen, die jede 0,1%ige Erschütterung an uns melden. Entsprechende Reaktionen vor und hinter der vermittelnden Mattscheibe.
Das was zuvor konsensverdächtig aussah, wird nun zum Reziprokwert. Alle Positionen mit -1 multiplizieren – das wird zum Motto und schafft ausreichend Spielraum für Nichtkonsens. Dann wird Theater gespielt, der Eklat zuvor noch inszeniert. Kulminierend nach der drittten Vergewisserung – „Sie kennen meine Aufassung“. Man wertet mit „ja“; nicht mit einer Enthaltung. Ebenso Theater.
Das Land steckt fest in sich selbst. Steckt fest in den Köpfen der Menschen. Die Politik scheint nicht wirklich Entscheidungen für das Volk treffen zu können, zu tief steckt sie in parteipolitischen Konstellationen. Parteien, Politiker und Wirtschaft stecken tief in der Korruption, die sonst Entwicklungsländern vorgeworfen wird. Mehrheitsverhältnisse sind keine mehr, Entscheidungen lassen sich nur mit allerletzter Kraft realisieren. Auf Kosten der Politik, der Glaubwürdigkeit. Der Wille zum Abbau des Reformstaus ist nicht erkennbar. Der Wille, nicht inszenierte Politik zu machen erst recht nicht.
-
Was wirklich gute Nutzbarkeit (aka Usability, aka GUI), aber auch ansprechende Inhalte betrifft: Paranews. Weblog-ähnliches ist zu umfangreicheren Magazinen ausbaubar.
-
Gefällt mir gut. Der Rollover Effekt bei Wurmi.
-
-
Wo geht er hin, der ganze Elektromüll? Der digitale Überfluss?
Während alles Materielle in Tonnen oder Eimern, auf Halden oder in der Umwelt endet, macht sich das Digiale auf den Weg nach… Ja wohin denn eigentlich? Was wiederfährt den Unmengen von Dateien, die täglich mit einem Rascheln in der Papierkorb verschoben werden. Was mit den Inhalten sogenannter temporärer Verzeichnisse? Virtuelle Existenzen, deren Nachname schon von einem Stunden oder bestenfalls Tagen dauernden Leben zeugt.
Wo trifft man die Mailbox des Handies, die man zwar noch abhören und posthum besprechen kann, das Telefon selbst aber unerreichbar irgendwo liegt. Wohin verweisen die toten Links zu meiner alten Domain? Was denken sich die, die sie nicht erreichen?Gut, dass wir für die Toten und ihre Hinterbliebenen den Himmel geschaffen haben. Liegen all die verloren Bits da neben ihnen, auf einer weichen Wolke vielleicht. Oder ruhen sie dort, wo die Seelen hingehen? Ja, wohin denn eigentlich?
Gedanken aus einem netten Gespräch, spät abends, bei einer Flasche Rotwein.
-
Während der Recherche für einen Beitrag in der kommenden Ausgabe der Navigationen wunderte ich mich darüber, dass neu auf den Markt kommende Medien so eine lange Phase der Orientierungs- oder besser, Inhaltslosigkeit durch machen müssen.
Man werfe dazu einen Blick zurück auf das junge Radio, das lediglich die Kopie älterer Medieninhalte war. Theater, Konzert oder Lokalzeitung – den Verkehrsfunk erfand man später.
Beim Fernsehen war es ähnlich. Spricht man über die modernen Massenmedien Radío und Fernsehen, so handelt es sich beim Rundfunk im Grunde um das erste jener Massenmedien. Beim Fernsehstart hätte man allerdings auf Basis der Erfahrungen reagieren können. Immerhin handelt es sich ebenso wie beim Radio um einen Rundfunkdienst.Und was ist los im Internet? Sehen wir nicht überwiegend Inhalte (wenn überhaupt Inhalte), die irgendetwas entsprechen, nicht aber den Strukturen und Potentialen des Netzes.
Wieso ist das so? Ist es überhaupt so? Jedenfalls kann man über die Veränderung von Diskursen sprechen. Besser gesagt: Die Veränderung von Diskursen zitieren, denn so etwas stammt natürlich nicht aus meinem Köpfchen, sondern aus dem Vilem Flussers. Jedenfalls scheint es, als dass man, spricht man über das Netz, nicht bedacht hat, dass die Art des Diskurses, wie er in einem Medium abläuft, sich verändert.Massenmedien wie Radio und TV bestehen aus Amphitheaterdiskursen. Diese Struktur besteht im wesentlichen aus zwei Elementen: Einem im Raum schwebenden Sender sowie den ausstrahlenden Kanälen, die die spezifischen Codes transportieren. Zeitungspapier, Hertzwellen oder Filmrollen. Die Empfänger sind vielzählig aber klein, ganz klein. Wie Satelliten sind sie um die Sender herum angeordnet. Organisatorisch befinden Sie sich am Rande, fast außerhalb des Diskurses. Sie sind gewissermaßen geeicht auf jeweils einen Kanal, der Informationen in den Sender pumpt. Dieses Modell ist eher totalitär. Es ist das Modell der Massenmedien.
Im Netz finden keine Diskurse statt, sondern Dialoge. Prototypen für Netzdialoge sind die Post und das Telefonsystem. Plauderei, Geschwätz oder Gerüchte gehören allerdings ebenso dazu. Wichtig erscheint mir Flussers Feststellung, dass Informationen nicht aus der Synthese von bereits vorhanden Informationen entstehen (wie es eben doch überwiegend der Fall ist – siehe These zu Beginn), sondern dass Informationen spontan durch die Verformung von Inhalten (z.B. durch Geräusche, durch das Netzgeflüster) entstehen. Das Ziel der Politik sollten Netzdialoge sein. Sie schaffen neue Informationen statt die alte Informationen redundant zu wiederholen, wie es beim Rundfunk geschieht, der so eine Veränderung des Menschen verhindert.
-
Media Links ahead: Telepolis/ Medientheorie – Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Beiträge von Frank Hartmann, Geert Lovink, Hartmut Winkler sowie der Agentur Bilwet.
Sehr interessant ist CultD. Überzeugend vor allem durch die Fülle des Angebots und durch die interessante Gestaltung.