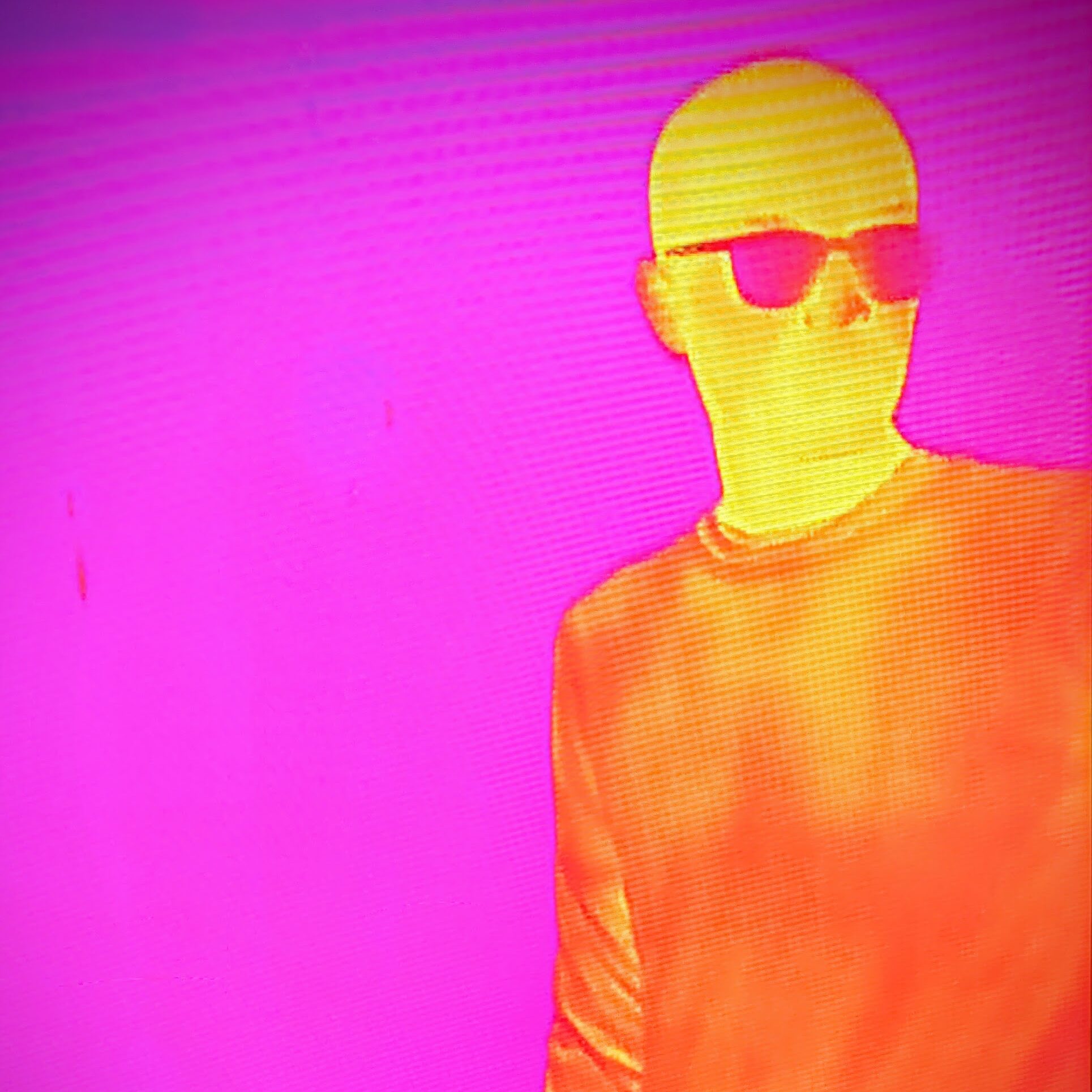-
-

-
-
-
»Lieber Herr L«
»Einige Informationen für Sie zum Stand der Dinge. Wir hatten ja vereinbart, um den 20. herum das Thema zu fixieren. Im letzten Gespräch hatte ich Ihnen die quantitative Analyse der Feuilletonartikel vorgelegt. Ich habe sie mittlerweile zumindest grob qualifiziert (im Anhang finden Sie die tabellarische Übersicht). Im Grunde gilt es ja nun zu klären, ob meine Arbeit im Sinne einer Theorie des Feuilletons angelegt ist oder ob es sich um eine Untersuchung zur Zirkulationsfähigkeit postmoderner theoretischer Konzeptionen/ Theorien handelt.
Ich würde hier gerne wissen, ob wir übereinstimmen: Sicherlich gibt es theoretische Konzeptionen, die zu zirkulieren beginnen. Es gibt in den Texten so etwas wie eine starke Verdichtung von Theorie, die sich in Feststellungen wie „der Theoretiker der Simulation“, „Geschwindigkeitstheoretiker“ o.ä. manifestiert. Festzustellen ist auch, die Fragmentierung von Theorie, wie z.B. die Applizierung der Baudrillardschen Terrorismusausführungen auf die WTC Anschläge. Andererseits wird Virilio aber auch dann herangezogen, wenn der Serienstart von „Fastlane“ angekündigt wird und innerhalb von zwei Zeilen schnelle Verfolgungsaction mit Dromologischem unterfüttert wird. Von halbwegs ernster Auseinandersetzung bis zu Nonsens ist es ein ganz kurzer Weg.
Zum Kern: Die (auch nur ansatzweise) theoretische Auseinandersetzung mit entsprechenden generellen Ontologien ist sehr selten. Oft dagegen Namedropping und kontextloses Zitieren als bloßes Ornament. Oft auch im Sinne eines schließenden Bonmots im letzten Abschnitt eines Textes. Ich bin mir nicht im Klaren, ob ich, auch im Hinblick auf das Volumen der Arbeit, erschöpfend und erkenntnisgewinnend arbeiten kann. Was meinen Sie?
Festzuhalten bleibt dennoch: Die Theorien und Autoren halten sich im Feuilleton. Auch angesichts der reinen Vielzahl von Texten, freunde ich mich mit der Sichtweise eines regelrechten Feuilleton/ Theorie-Betriebes an, bzw. eine Diskursökonomie des Feuilletons (kann Winkler mit seiner Diskursökonomie (http://wwwcs.upb.de/~winkler/index.html ) hier Pate stehen?).
Oftmals sind es externe Ereignisse, die Konjunktur oder Zirkulation in Gang setzen. Ich denke vor allem an die größeren Debatten um „The Matrix“ (Simulation), die WTC-Auseinandersetzungen und den Irakkrieg. Aber auch z.B. das Stattfinden einer von Paul Virilio initiierten Ausstellung zieht eben Viriliotheoretisches nach sich. Die Zirkulation also allein aus dem Theoriedesign, der Argumentationstechnik o.ä herzuleiten erscheint mir vorderhand als nicht ausreichend und nur partiell erklärend. Bezieht man jedoch außertheoretische Impulse mit ein, so ist es nicht weit zu der von Ihnen vorgeschlagenen Theorie des Feuilletons. Sehen Sie das ähnlich?
Noch etwas: Wie verhalte ich mich zu den modernen, generellen Theoretikern? Habermas, Enzensberger und Eco wollte ich heraushalten, das hatten wir besprochen. Bliebe Benjamin, den ich im Feuilleton noch nicht komplett analysieren konnte. Mir scheint jedoch auch hier, daß es oftmals das textliche Ornament ist, das zählt. Speziell bei Benjamin kommt hinzu, daß vielfach der Literat, nicht der Theoretiker und lediglich dann und wann die Reproduktion ins Spiel kommt. In der Masse von Benjamin-Feuilletons kenne ich schlicht auch nicht den Literaten. Seine Publikationsliste ist mir – was die Arbeit betrifft – ein wenig zu lang, muß ich sagen.
Frau S habe ich auf die elektronische „Zeit“ angesprochen. Ich fürchte jedoch, daß die Entscheidung zu lange brauchen wird, um die Zeit mit ins Boot zu nehmen. Mal gucken. (Ich sehe allerdings gerade, daß online Einiges zu holen wäre)« -
Striker. Obs echt ist? Man weiß ja nie.
-
-
-
-