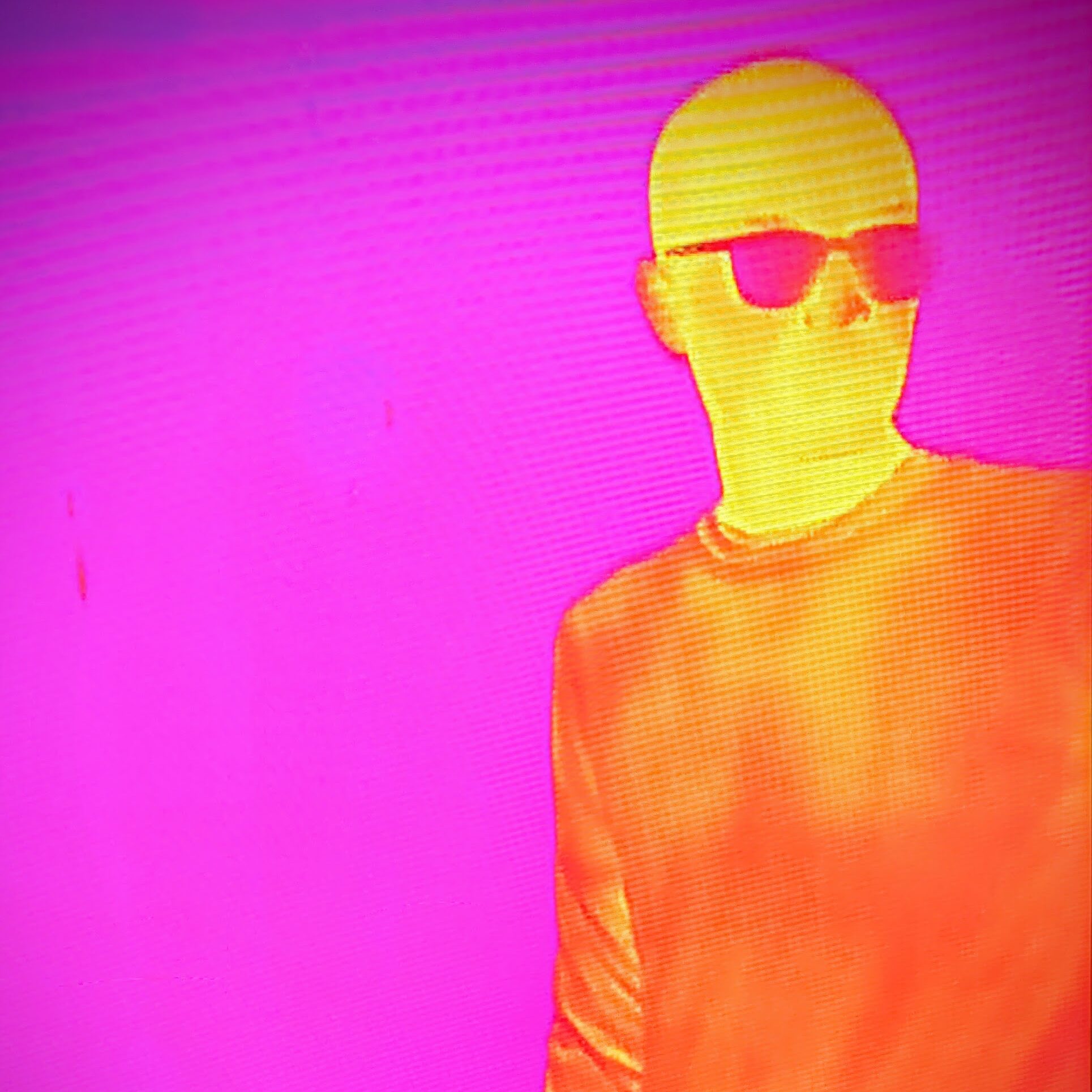White Russian am nachmittag. Scheinbar geht das Semester wieder los.
-
-
Wow, sie haben den Aufmacher daraus gemacht (Der Link wird nur heute aktuell sein; nicht wundern).
-
Alles Liebe zum anniversaire. Solltest lieber hier sein als dort.
-
Hier ist das Wahlposting das ich gar nicht schreiben will, da ich damit momentan durch bin und dazu auch nichts mehr sagen muss außer, dass ich in meine Seiten kurz vor meinem Tod zurückblättern und dann das Wahlposting, das ich gar nicht mehr schreiben wollte wiederfinden will.
-
Zur Krise der Zeitungen wird momentan viel geschrieben. Kürzt man unwichtiges aus den fachlichen Publikationen heraus, wird schnell offensichtlich, dass Uneinigkeit herrscht: Sehen die einen die Gründe in der handfesten Konjunkturkrise seit New Economy Sterben und 9/11, sehen die anderen eine Strukturkrise. Das Internet sei schuld. Nun, ja. Hört man Helmut Heinen, den Chef des BDZV, über das Potential des Netzes, dann kann man ebenso die Unternehmensphilosophien x-beliebiger Contentprovider lesen. Neu ist das nicht; vermeidbar wohl auch nicht.
Frank Schirrmacher schreibt heute in der FAZ weder von einer Struktur- noch einer Konjunkturkrise. Er beschreibt in einem meiner Meinung nach nicht unwichtigem Text über die Krise der Zeitungskultur.
Die einleitende Passage daraus:- „Wollte man den Kreativitätskern des deutschen Intellektuellen als Formel in die Bilanz einstellen, so ergäbe sich folgende Berechnungsgrundlage: Zwanziger Jahre minus Hitler minus Leninismus/Stalinismus plus Bundesrepublik minus RTL. Kein Kritiker, der nicht ein bißchen Kerr, kein Korrespondent, der nicht ein wenig Kracauer, kein Dramatiker, der nicht Brecht, kein Rezensent, der nicht auch Benjamin, kein Rezensionsorgan, das nicht gerne „Literarische Welt“ heißen wollte.
Das ist nicht Usurpation. Die Maßstäbe, auf die wir uns beziehen, sind achtzig Jahre alt. Aber sie sind groß und bedeutend, und die Kraft, die sie entwickelten, war ungeheuer. Denn es waren die Medien, die großen und kleineren Zeitungen, das Radio und auch teilweise das Fernsehen, die daraus jene geistige Wirklichkeit schufen, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, daß wir nicht ahnen, was ihr Verschwinden bedeuten würde. Natürlich gab es das nicht mehr oder jedenfalls kaum noch: Kerr oder Brecht oder Kracauer, wenngleich viele der täglich erscheinenden Essays oder Kritiken den Vergleich mit den großen Vorbildern nicht zu scheuen brauchten. Aber die seriösen Medien, ihre Redakteure und Leser schufen die Voraussetzungen für unzählige intellektuelle Biographien, ja für geistige Karrieren, die gleichberechtigt neben den Laufbahnen des rein Ökonomischen standen. Sie gaben und geben festen freien Mitarbeitern – bei oft sehr guten ökonomischen Bedingungen – die Möglichkeit, das freie Leben des Geistigen zu führen, ohne den Preis der Wirkungslosigkeit zu zahlen.“
-
„Das Museum, die Sammlung, der Direktor und seine Liebschaften“
- Suchen, Zeigen, Warten, Verbergen, Erinnern, Verbinden, Befragen, das sind für Udo Kittelmann die Funktionen eines Museums für zeitgenössische Kunst – nicht Einordnen, Abhaken, Einsortieren. Udo Kittelmann folgt Jean-Christophe Amman im MMK. Start: Heute um 18 Uhr
-
Ist es eigentlich ein Entsagen an Urbanität, wenn ein Ruhrgebietsmensch lieber sein Rad durch den Taunus und auf seine Gipfel pedaliert, statt Frankfurts U-Bahn, Hochhäuser und Straßencafes zu frequentieren?
-
Der 11. September jährt sich nun. Man zeigte sich damals wie heute erschüttert ob der Gewaltigkeit mit der wenige Attentäter die westliche Vorstellung eines im großen und ganzen recht unbeschwerten Lebens zum einstürzen brachten. Und scheinbar braucht es eine derart enorme Erschütterung, um dem westlichen Habitus deutlich zu machen: Es gibt Menschen, die unter dieser Idee eines Lebens zu leiden haben. Sicherlich – ich persönlich nehme Teil an diesem Leben. Und sehe Sinn in Demokratie, Pluralismus, Freiheit im Denken, Konsum und Spaß. Müssten nicht all diese Attribute eines westliche Lebens verständnisvoll mit den Vorstellungen eines wie auch immer anders gearteten Lebens umgehen.
Dass es sich genau so nicht verhält, zeigten bisher am deutlichsten die Anschläge von New York. Natürlich zeigen sie ebenso, dass andere keinen Deut mehr Respekt vor dem Leben haben.
Man dreht sich also allzuleicht im Kreis. Oder kommt zu dem Entschluß, alle Menschen seien schlecht. Vielleicht gehört ein solches Dilemma zum irdischen Leben. Sicherlich ist zu viel geschehen, um die Schraube einfach zurück zu drehen.
Wie die langfristigen Konsequenzen aussehen mögen kann ich nicht erahnen. Wie der anhaltende Krieg gegen… – nun diese Frage scheint der militante Aktionismus nicht zu kennen – … zeigt, werden Menschenleben nach wie vor nicht viel wert sein. Es soll Weltordung erkämpft werden. Was angesichts der militärischen Überlegenheit des Westens früher oder später geschehen kann. In welcher Form die erste Welt die übrigen Welten dominieren wird, spielt vielleicht erst in zweiter Instanz ein Rolle. Militärisch, ökonomisch, religiös – alles scheint momentan möglich.
Und geht seinen globalisierten Weg. Ohne großartig nach links oder rechts ausscheren zu können. Irgendwelche Kräfte (oder man selbst?!) lassen weniger und weniger Alternativen zu. Ich kann mir nicht vorstellen wie sich grundlegend etwas ändern kann.
-
Das ist der Süddeutschen zurecht aufgefallen: Eine Schau elektronischer Künste, egal als wie weit entwickelt man dieses Feld betrachtet, kann unplugged nicht funktionieren. Sie funktioniert ja auch nur in kleinen Teilen der Welt. Wer schaltet also im Rest der Welt den Strom an? Nun, hört die SZ:
- „Der Aufruf zur Repolitisierung der Kunst, wie er auch aus Kassel von der documenta zu hören ist. Allein, die aktive Beteiligung an einer Netzrevolution setzt den Zugang zum Netz voraus. Und den hält immer noch (fast) exklusiv die Erste Welt. Ob Netzbeteiligung nun durch mangelnde Ressourcen, sprich Anschlüsse und Hardware, oder – wie Stocker meint – ideologisch verhindert wird, spielt keine Rolle: Weite Teile der globalisierten Welt sind schlichtweg „unplugged“ – nicht vernetzt. Und darauf aufmerksam zu machen, ist denn auch das tatsächliche Motiv gewesen, eine Ars Electronica so unglücklich und sich anscheinend selbst annihilierend zu betiteln. „
-
So. Seite abgeschickt. Wie immer `ne halbe Stunde nach Redaktionsschluß. Vielleicht ist Sophie daran schuld. Schöne Fototechniken und die angenommene analog-digital-Flanke aus der Tiefe der Schweiz. Wenn ich den digital verloren gegangenen Referenten gefunden habe melde ich mich textuell.