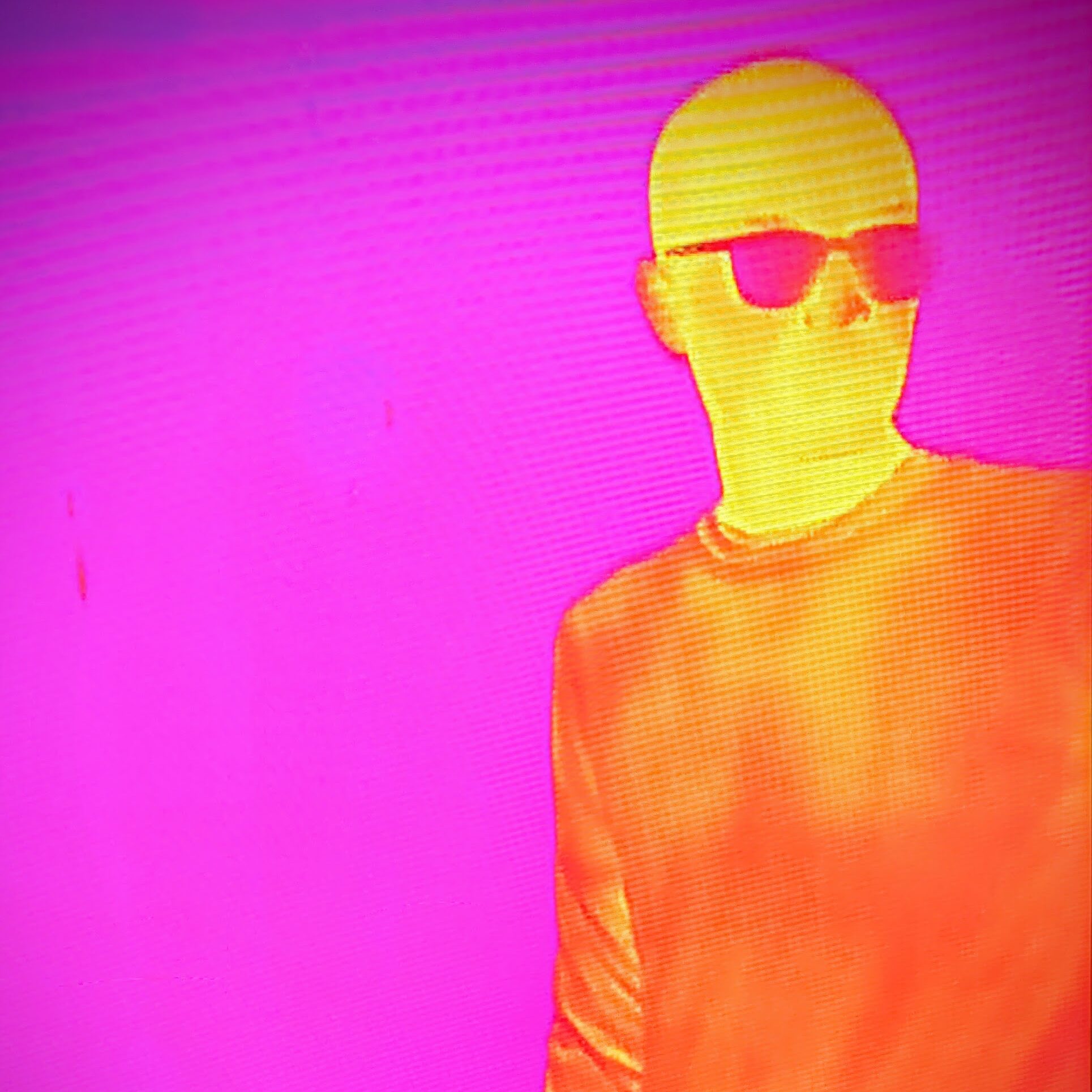Macba/ Barcelona. Keine Details. Flächen, die eisglatt – wie mit einem Messer geschnitten – erscheinen. Durch den Schnitt Licht fallend.
Das Macba von Richard Meier. Gefunden beim hervorragenden thingsmagazine.
-
-
-
-
Albert Hofmann entdeckte vor 60 Jahren LSD. Hätte gedacht, es nutzt zu mehr als zum Schnibbeln von Schablonen.
-
Dr. Hofmann – Pochoir Barcelona. Galerie bei Barceloca. Und geknipst. Die Altstadt in Barcelona ist voll davon. Sinnentleerte Botschaften á la Jean Baudrillard ?
-
Close this window: Re-Election blog.
-

-
Einzig ein paar Studenten aus Chemnitz haben wohl mit der Diagnose des »waffenstarrenden Vielleicht« die gegenwärtige positionslose Attitude der vier oder fünf großen Feuilletons beschrieben.
Dass konstruktive und wirkungsmächtige Kritik an der eigenen Arbeit nicht von (hier) den Feuilletons selbst geübt wird, dürfte klar sein.
Allenfalls die Diagnose wird noch getätigt. Der Missstand kurz angezeigt, um die Debatte abzuschließen. In allen jüngeren Anfällen von Selbstzweifel scheinen innere diese zentrifugalen Kräfte auszubalancieren. Sei es der knackig kritische Diskurs über die stets instrumentalisierte Berichterstattung von Kriegen o.ä., die Mäßigungsattacken nach Gewaltausbrüchen á la Erfurt, die gerne an runden grünen Tischen aus Medien und Politik geritten werden.
Oder eben die aktuellen Debatte über die Konturlosigkeit des Feuilletons, die auch nicht aus dem Inneren der Redaktionen heraus behoben werden wird. Überhaupt ist diese Frage natürlich eine des Standpunktes. Und auch eine der Analyse. Wohl exemplarisch ist die Rede vom »waffenstarrenden Vielleicht« zustande gekommen. Auf mehr als zwei analysierte Texte verweisen die Chemnitzer nämlich nicht.
Vielleicht kann ich aber nachlegen: Und wenn Sie hier schon wieder den Namen Baudrillard lesen und es gleichzeitig nicht mehr können. Ok. Mir fällt`s auch schwer momentan. Und ich bin froh, dass das Ding durch ist.
Wen`s dennoch interessiert. Ein paar Zeilen einer Arbeit aus diesem Jahr. Sie behandelt die feuilletonistische Fragmentierung der Medientheorie, wie sie im symbolischen Tausch von Jean Baudrillard angelegt ist. Den kompletten Text verschicke ich gerne auf Anfrage in den Kommentaren.
bq. »Zu Beginn des Films „The Matrix« [1] hält der Protagonist Thomas A. Anderson alias Neo Jean Baudrillards Titel »Simulacra und Simulations« in den Händen. Der Blick des Betrachters fällt über Andersons Schultern auf das aufgeschlagene Kapitel »On Nihilism«. In den folgenden, ausgehöhlten Seiten des Buches ist ein Datenträger verborgen. Es ist eine gleichermaßen illegale wie heißbegehrte Computersimulation, mit deren Verleih Anderson seinen Lebensunterhalt aufbessert.
bq. Mit der kurzen Beschreibung dieser Filmszene soll exemplarisch das Eindringen diverser Fragmente des Baudrillardschen Theoriegebäudes nicht nur in ein fiktionales und kommerziell erfolgreiches Medienprodukt wie »The Matrix«, sondern vor allem in die breiteren, nicht-wissenschaftlichen Debatten der Feuilletons [2] angedeutet werden. Bohn und Fuderer verweisen darauf, dass z.B. Baudrillards zentrales Konzept der Simulation zu einem »feuilletonistischen Allgemeinplatz« wurde [3]. Dieses vollzieht sich nicht, so eine einleitenden These, ohne Schaden am theoretischen Gehalt der postmodernen Konzepte Baudrillards, die ohnehin stark in der wissenschaftlichen Kritik stehen [4]. Der Verweis auf einen feuilletonistischen ‘Allgemeinplatz’ lässt jedoch auch Rückschlüsse auf die Form zu, in der Medientheorien bzw. deren Fragmente im Journalismus zirkulieren.
bq. In dieser Arbeit soll gezeigt werden, mit welchen Theoriekonzepten Jean Baudrillard arbeitet, und wie sich diese in den erwähnten »feuilletonistischen Allgemeinplätzen« artikulieren.
Im Verlauf dieser Arbeit sollen diejenigen Feuilleton-Artikel der Jahrgänge 2001 und 2002 der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie der Süddeutschen Zeitung analysiert werden, in denen der Autor Baudrillard bzw. zentrale Begriffe seines Hauptwerkes »Der symbolische Tausch und der Tod« [5] thematisiert oder, in welcher Form auch immer, schlicht erwähnt werden.
Zunächst wird der Versuch unternommen, die verschiedenen Artikel im Hinblick auf die verwendeten Baudrillardschen Konzepte bzw. die je Artikel verwendeten Bezüge zu Baudrillard zu typologisieren. Daraufhin werden diese Gruppen auf die journalistische Funktion untersucht, die die jeweils verwendeten theoretischen Konzepte und Bezüge auf Baudrillard haben. In einem dritten Schritt werden die in den Artikeln verwendeten Konzepte mit ihren Referenzen im Symbolischen Tausch konfrontiert. Im Vergleich zu bestimmten argumentativen Mustern bzw. Elementen einer Baudrillardschen Rhetorik soll kontrastiert werden, inwiefern diese es ermöglichen, Medientheorie in journalistischen Diskursen bzw. den erwähnten feuilletonistischen Allgemeinplätzen nicht nur zirkulieren zu lassen, sondern auch das diskursive Niveau einer universal angelegten Medientheorie zu beeinflussen.
bq. Die Naturwissenschaftler Alan Sokal und Jean Bricmont [6] betrieben ein ähnliches Unternehmen. In ihren Studien wiesen sie nach, dass einige prominente Autoren der französischen Postmoderne in ihren Werken eine Terminologie gebrauchen, mit der wissenschaftliche Ideen und Begriffe aus ihren ursprünglichen konzeptionellen Zusammenhängen gerissen wurden und so nicht nur ihren Theorien, sondern auch dem Status Quo und der Akzeptanz postmoderner Theorie, wenn nicht dem System Wissenschaft Schaden zufügten. Bezog sich Sokals und Bricmonts Analyse auf (unzulässig) entwendete naturwissenschaftliche Konzepte und Modelle, so soll ihr Gedanke einer postmodernen &+#187;eleganten Rhetorik« in dieser Arbeit weiter gedacht werden und Aufschlüsse über die Art und Weise geben, wie Baudrillard seine theoretischen Konzepte formuliert und welche Probleme daraus in der feuilletonistischen Rezeption entstehen.«
Und weil sie so schön sind. Und zu Thema und baldigem Urlaub passen: Guillemets statt Anführungszeichen. -
Blast Theory gewinnen den Interactive Art der Ars Electronica.
For two days, players online were able to play against members of Blast Theory in a chase live on the streets of Sheffield.
Online, your player was dropped onto a map of Sheffield city centre. On the streets, tracked by satellites, Blast Theory runners used handheld scanners to track you down.
bq. „With up to 20 people playing online at a time, players could exchange tactics and send messages while an audio stream from Blast Theory’s walkie talkies allowed you to eavesdrop on your pursuers: getting lost, cold and out of breathe on the streets of Sheffield.“ -