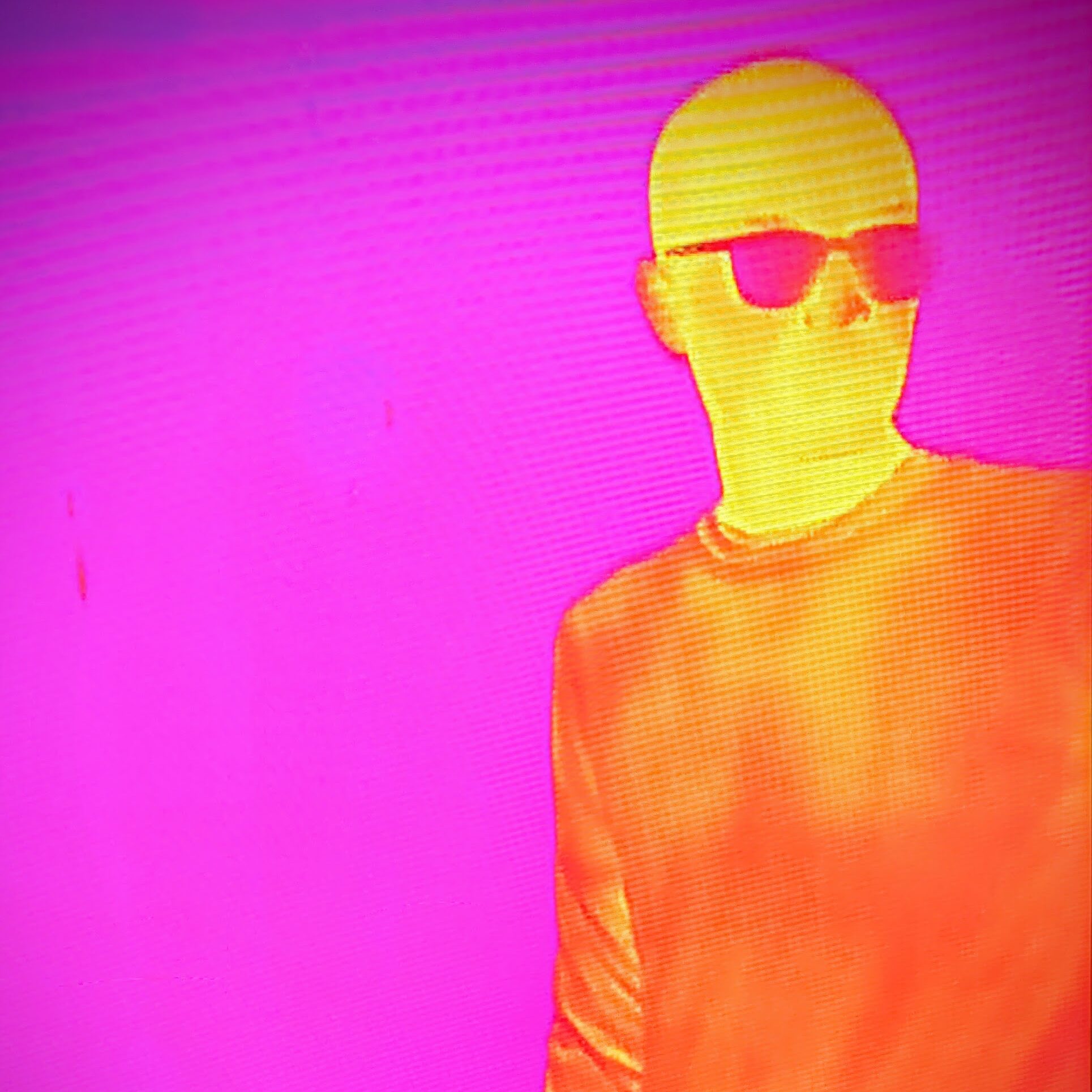Zur Krise der Zeitungen wird momentan viel geschrieben. Kürzt man unwichtiges aus den fachlichen Publikationen heraus, wird schnell offensichtlich, dass Uneinigkeit herrscht: Sehen die einen die Gründe in der handfesten Konjunkturkrise seit New Economy Sterben und 9/11, sehen die anderen eine Strukturkrise. Das Internet sei schuld. Nun, ja. Hört man Helmut Heinen, den Chef des BDZV, über das Potential des Netzes, dann kann man ebenso die Unternehmensphilosophien x-beliebiger Contentprovider lesen. Neu ist das nicht; vermeidbar wohl auch nicht.
Frank Schirrmacher schreibt heute in der FAZ weder von einer Struktur- noch einer Konjunkturkrise. Er beschreibt in einem meiner Meinung nach nicht unwichtigem Text über die Krise der Zeitungskultur.
Die einleitende Passage daraus:
- „Wollte man den Kreativitätskern des deutschen Intellektuellen als Formel in die Bilanz einstellen, so ergäbe sich folgende Berechnungsgrundlage: Zwanziger Jahre minus Hitler minus Leninismus/Stalinismus plus Bundesrepublik minus RTL. Kein Kritiker, der nicht ein bißchen Kerr, kein Korrespondent, der nicht ein wenig Kracauer, kein Dramatiker, der nicht Brecht, kein Rezensent, der nicht auch Benjamin, kein Rezensionsorgan, das nicht gerne „Literarische Welt“ heißen wollte.
Das ist nicht Usurpation. Die Maßstäbe, auf die wir uns beziehen, sind achtzig Jahre alt. Aber sie sind groß und bedeutend, und die Kraft, die sie entwickelten, war ungeheuer. Denn es waren die Medien, die großen und kleineren Zeitungen, das Radio und auch teilweise das Fernsehen, die daraus jene geistige Wirklichkeit schufen, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, daß wir nicht ahnen, was ihr Verschwinden bedeuten würde. Natürlich gab es das nicht mehr oder jedenfalls kaum noch: Kerr oder Brecht oder Kracauer, wenngleich viele der täglich erscheinenden Essays oder Kritiken den Vergleich mit den großen Vorbildern nicht zu scheuen brauchten. Aber die seriösen Medien, ihre Redakteure und Leser schufen die Voraussetzungen für unzählige intellektuelle Biographien, ja für geistige Karrieren, die gleichberechtigt neben den Laufbahnen des rein Ökonomischen standen. Sie gaben und geben festen freien Mitarbeitern – bei oft sehr guten ökonomischen Bedingungen – die Möglichkeit, das freie Leben des Geistigen zu führen, ohne den Preis der Wirkungslosigkeit zu zahlen.“