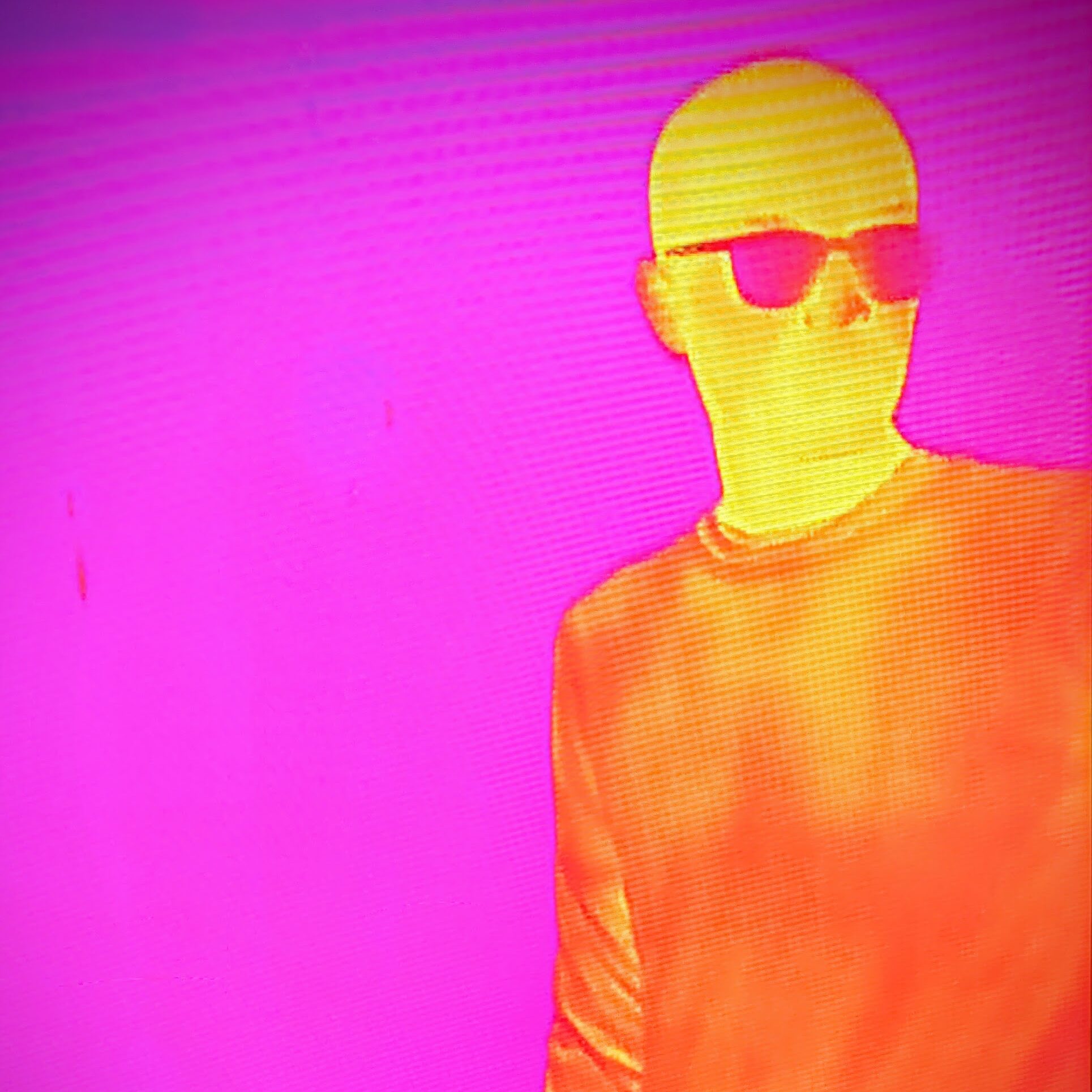Sah vorhin den 20. Spiegel des Jahres 1988 herumliegen. Ezensbergers wunderbares Essay über das Nullmedium. Ich hoffe, die Auslassungen enstellen ihn nicht. Und: Vergeßt den Baukasten!
bq. Fernsehen verblödet: Auf diese schlichte These laufen so gut wie alle landläufigen Medientheorien hinaus, gleichgültig, wie fein gesponnen oder grob gewirkt sie daherkommen. Der Befund wird in der Regel mit einem gramvollen Unterton vorgetragen. Vier hauptsächliche Varianten lassen sich unterscheiden.
bq. Die Manipulationsthese zielt auf die ideologische Dimension, die den Medien zugeschrieben wird. Sie sieht in ihnen vor allem Instrumente politischer Herrschaft und ist von ehrwürdigem Alter. Ursprünglich tief in den Traditionen der Linken verwurzelt, aber bei Bedarf auch von der Rechten genießerisch adoptiert, hat sie es ganz auf die Inhalte abgesehen, die vermeintlich das Programm der großen Medien bestimmen.
bq. Ihrer Kritik liegen Vorstellungen von Propaganda und Agitation zugrunde, .wie sie aus früheren Zeiten überliefert sind. Das Medium wird als ein indifferentes Gefäß verstanden, das über ein passiv gedachtes Publikum Meinungen ausgießt. Je nach dem Standpunkt des Kritikers gelten diese Meinungen als falsch; sie müssen mich einem derartigen Wirkungsmodell notwendig falsches Bewusstsein erzeugen. Verfeinerte Methoden der Ideologiekritik erweitern diesen „Verblendungszusammenhang“, indem sie den Gegner mit immer subtileren und heimtückischeren Absichten ausstatten. An die Stelle der direkten Agitation tritt dann die schwer durchschaubare Verführung; der ahnungslose Konsument wird von den Drahtziehern überredet, ohne dass er wüsste, wie ihm geschieht.
bq. Die Nachahmungsthese argumentiert dagegen moralisch. In ihren Augen bringt der Medienkonsum vor allem sittliche Gefahren mit sich. Wer sich ihm aussetzt, wird an Libertinage Verantwortungslosigkeit, Verbrechen und Gewalt gewöhnt. Die subjektiven Folgen sind abgestumpfte, verhärtete und verstockte Individuen, die objektiven der Verlust sozialer Tugenden und der allgemeine Sittenverfall.
bq. […]
bq. Neueren Datums ist die Simulationsthese, die von einem erkenntnis-theoretischen Verdacht beseelt ist. Sie ist auch insofern moderner, als sie auf die technische Entfaltung der Medien eingeht, also auch die Existenz des Fernsehens ernst nimmt, was man von ihren Vorgängern nicht behaupten kann. Ihr zufolge wird der Zuschauer durch das Medium außerstande gesetzt, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden. Die erste Realität werde also durch eine zweite, phantomhafte unkenntlich gemacht oder ersetzt.
Eine weitergehende Version der These, die gelegentlich sogar affirmativ auftritt, kehrt dieses Verhältnis um und behauptet, die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Simulation sei unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen sinnlos geworden.
bq. Alle bisherigen konvergieren in der vierten, der Verblödungsthese, die sich zu einer anthropologischen Aussage verdichtet. Die Medien greifen, wenn man ihr folgt, nicht nur das Kritik- und Unterscheidungsvermögen, nicht nur die moralische und politische Substanz ihrer Nutzer an, sondern auch ihr Wahrnehmungsvermögen, ja, ihre psychische Identität. Sie produzieren somit, wenn man sie gewähren läßt, einen Neuen Menschen, den man sich, je nach Belieben, als Zombie oder Mutanten vorstellen kann.
bq. Alle diese Theorien sind schwach auf der Brust. Beweise halten ihre Urheber für entbehrlich. Selbst das Minimalkriterium der Plausibilität macht ihnen keinerlei Kopfzerbrechen. So ist es, um .nur ein Beispiel zu nennen, bisher niemandem gelungen, uns außerhalb der psychiatrischen Klinik auch nur einen „Fernsehteilnehmer“ vorzuführen, der außerstande wäre, zwischen einem Ehekrach in der laufenden Serie und an seinem Frühstückstisch zu unterscheiden. Die Verfechter der Simulationsthese scheint das nicht zu stören.
bq. Die Industrie teilt weder dieses leidenschaftliche Verlang noch jene dürren Theorien. Ihre Überlegungen sind von asketischer Nüchternheit. Sie kreisen einerseits um Frequenz_ Kanäle, Normen, Kabel, Keulen, Parabolantennen; andererseits um Investitionen, Beteiligungen, Verteilungsschlüssel Kosten, Quoten, Werbeaufkommen. Aus dieser Perspektive erscheint als das eigentlich Neue an den Neuen Medien Tatsache, dass keiner ihrer Veranstalter jemals auch nur einen Gedanken an irgendwelche Inhalte verschwendet hat.
Jeder wirtschaftliche, technische, rechtliche und administrative Aspekt ihres Vorgehens wird eingehend analysiert und erbittert umkämpft. Nur ein Faktor spielt im Sinnen und Trachten der Industrie keine Rolle: das Programm. Zur Debatte steht, wer zahlt und wer kassiert, wann, wo, wie, von wem aber nie und nimmer, was gesendet wird. Eine solche Haltung wäre bei keinem früheren Medium denkbar gewesen.
bq. Sie könnte sonderbar, ja verwegen scheinen. Es werden Milliarden aufgewendet, um Satelliten in den Weltraum zu schießen und ganz Mitteleuropa mit einem Kabelnetz zu durchziehen; eine beispiellose Aufrüstung von „Kommunikationsmitteln“ findet statt, ohne dass irgend jemand die Frage aufwarf was da eigentlich mitgeteilt werden soll.
Die Lösung dieses Rätsels liegt jedoch auf der Hand. Die Industrie nämlich weiß sich mit der entscheidenden gesellschaftlichen Figur in ihrem Spiel einverstanden: mit der des „Fernsehteilnehmers“. Dieser, keineswegs willenlos, steuere energisch einen Zustand an, den man als Programmlosigkeit_ bezeichnen kann. Um diesem Ziel näherzukommen, benut er virtuos alle verfügbaren Knöpfe seiner Fernbedienung.
Gegen diese innige Allianz von Kunden und Lieferanten i kein Kraut gewachsen. Die verbitterte Minderheit der Kritik_ tut sich schwer, ein so massives Einverständnis zu erkläre!
bq. Auch der Begriff des Programms orientiert sich an der Schrift. Das Wort
bezeichnet ja laut Meyers Lexikon ursprünglich nichts anderes als das Vorgeschriebene oder vorher Geschriebene; „eigentlich öffentliche schriftliche Bekanntmachung, öffentlicher Anschlag, jetzt (1985) besonders eine Ankündigungs- oder Einladungsschrift, die von Universitäten und anderen höheren Bildungsanstalten erlassen wird. Im öffentlichen Leben spricht man vom Programm einer Partei, einer Zeitung, einer zu bestimmten Zwecken gegründeten Gesellschaft, auch einer Regierung, wenn in mehr oder weniger bindender Gestalt die Grundsätze des beabsichtigten Handeins im voraus verkündet werden“.
bq. Was dagegen die führenden Fernsehveranstalter im Voraus verkünden, liest sich so: „Budenzauber. Mini-ZiB. Ei elei, Kuck elei. Du schon wieder (8.). Wenn abends die Heide träumt. Almerisch g’sunga und g’schpuit Weltcup-Super G der Herren. Helmi. X-Large. Die Goldene Eins. Betthupferl. Bis die Falle zuschnappt. Einfach tierisch. Wetten, daß …? Es lebe die Liebe. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Just another pretty face. Tintifax und Max. Ich will, dass du mich liebst. Also ääährhrlich. Hulk (31.) Musi mit Metty. Heute mit uns. Hart wie Diamant. Am, dam, des. Barapapa: Texas Jack (12.). Schau hin und gewinn. Superflip. Sie er es. Liebe international. Hart aber herzlich. 1 _2-x. Wer bietet mehr?“
bq. […]
bq. Den entscheidenden Fortschritt jedoch erst die elektronischen Medien gebracht. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass dem Versuch, ein gedrucktes Nullmedium zu schaffen, unübewindliche Hindernisse im Wege stehen die Schrift von jeder Bedeutung befreit will, muss zu extremen Lösungen greifen. Die heroischen Vorschläge der Avantgarde (Dada, Lettrismus, visuelle Poesie) haben bei der Industrie kein Gehör gefunden. Das liegt vermutlich daran, dass die Idee der Null-Lektüre selbst widersprüchlich ist. Der Leser, jeder Leser hat nämlich den fatalen Hang, Zusammenhänge herzustellen und noch in der trübsten Buchstabensuppe nach so etwas wie einem Sinn herumzustochern.
Einem jüngeren Medium wie dem Radio durfte man sich schon weniger, und das heißt in diesem Zusammenhang mehr, versprechen. Die Emanzipation von der Schrift eröffnet zumindest neue Perspektiven. In der Praxis zeigte sich allerdings, dass im Rundfunk ziemlich viel vorgelesen wurde. Doch auch dort, wo die freie Rede sich Bahn brach, in Ansprache und Diskussionen, ja sogar im schieren Gequassel, stiften die Wörter immer wieder so etwas wie Bedeutung.
bq. […]
bq. In der Nullstellung liegt also nicht die Schwäche. Sondern die Stärke des Fernsehens. Sie macht seinen Gebrauchswert aus. Man schaltet das Gerät ein, um abzuschalten. (Aus diesem Grund ist übrigens das, was Politiker für Politik halten, absolut fernsehtauglich. Während der bedauernswerte Minister sich einbildet, die Ansichten und Handlungen des Zuschauers zu beeinflussen, befriedigt die seimige Leere seiner Äußerungen nur das Bedürfnis des Publikums, von Bedeutungen verschont zu bleiben.)
bq. Dagegen ereignet sich so etwas wie eine Bildstörung, sobald im Sendefluss ein Inhalt auftaucht, eine echte Nachricht oder gar ein Argument, das an die Außenwelt erinnert. Man stutzt, reibt sich die Augen, ist verstimmt und greift zur Fernbedienung. Diese äußerst zielbewusste Nutzung verdient endlich ernst genommen zu werden. Das Fernsehen wird primär als eine wohldefinierte Methode zur genußreichen Gehirnwäsche eingesetzt; es dient der individuellen Hygiene, der Selbstmeditation. Das Nullmedium ist die einzige universelle und massenhaft verbreitete Form der Psychotherapie.
bq. […]
bq. Wem diese Argumentation ex negativo zu düster ist, dem kann geholfen werden. Er braucht seinen Blick nur von den unangenehmen Tatsachen fort in höhere Sphären zu richten und die derzeit wieder einmal so beliebten ältesten Weisheitslehren der Menschheit zu Rate ziehen. Wenn nämlich unsere Konzentration ihr Maximum erreicht – das geht aus jedem esoterischen Taschenbuch einwandfrei hervor -, ist sie von Geistesabwesenheit nicht mehr zu unterscheiden, und umgekehrt: die extreme Zerstreuung schlägt in hypnotische Versenkung um.
bq. Insofern kommt der Wattebausch vor den Augen der Transzendentalen Meditation recht nahe. So ließe sich auch die quasi-religiöse Verehrung, die das Nullmedium genießt, zwanglos erklären: Es stellt die technische Annäherung an das Nirwana dar. Der Fernseher ist die buddhistische Maschine.
Zugegeben: Es handelt sich hier um ein utopisches Projekt, das, wie alle Utopien, kaum ohne einen Erdenrest zu verwirklichen ist. Was dem Säugling vergönnt ist, der Zustand völliger Selbstvergessenheit, das wird der Erwachsene nur schwer erreichen. Er hat es verlernt, seinen Wahrnehmungsapparat zu beschäftigen, ohne das, was er sieht, zu interpretieren. Ob er will oder nicht, er neigt dazu, auch dort so etwas wie Sinn herzustellen, wo gar keiner zu finden ist. Diese unwillkürliche Fokussierung wirkt sich beim Gebrauch des Nullmediums immer wieder störend aus. Ich kann im Zweifelsfall stets behaupten, ich sei schließlich kein Zombie und es gebe dort, wo ich hinblicke, doch immerhin etwas zu sehen, dieses oder jenes Bestimmte, so etwas wie den glimmenden Rest eines Inhalts. Deshalb ist es unvermeidlich, dass auch der geübte Fernseher hin und wieder einer solchen Mystifikation erliegt.
bq. Der Idealfall ist also unerreichbar. Man kann sich der vollkommenen Leere, wie dem absoluten Nullpunkt, nur asymptotisch nähern. Diese Schwierigkeit ist jedem Mystiker vertraut: Die Meditation führt nicht ins Nirwana, die Versenkung gelingt allenfalls punktuell, aber nicht endgültig, der kleine, Tod ist nicht der große. Immer moduliert ein minimales Signal, das Rauschen der Realität, die „Erfahrung der reinen Gegenstandslosigkeit“ (Kasimir Malewitsch).
Dennoch – die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sind und bleiben denkwürdig, auch wenn der Bildschirm sein großes Vorbild nie einholen wird, jenes Schwarze Quadrat aus dem Jahre 1915, das, strenggenommen, alle Sendungen des Nullmediums überflüssig macht.