Medienkonvergenz ist mein persönliches Reizwort. Wird es doch vorwiegend in medienökonomischen Lehrbüchern und im Kontext von Strategien der großen Medienmultis verwendet. Medienkonvergenz beschreibt, wie Inhalte und Strukturen jeweils zuvor existierender Einzelmedien in einem spezifisch neuen Medium fusionieren und den großen der Branche zunächst einmal nicht weniger als höhere Profite versprechen. Als die dot.com Blase immer weiter aufgepustet wurde, fungierte der Begriff der Medienkonvergenz als Sesam-öffne-dich für die Panzerschränke der Finanzierer. Zumindest im Bereich der digitalen online Medien wurde jedoch nicht Mehr konvergiert, als die altbekannten Inhalte Bild, Wort und Ton. Nicht gerade die Wiedererfindung des Rades.
Hanno Rauterberg schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit eine großartige Kritik der Medienkonvergenz. „How are you?” fragt Vodafone, dessen einstige feindlich Übernahme von Mannesmann D2 das ganze Land in eine kurze und schmerzhafte Empörung versetzte. Mit massiven Werbetats wetzte Chris Gent (?) diese tiefschneidende Scharte aus der deutschen Empfindsamkeit heraus. Vor einiger Zeit setzte Vodafone einen neuen Kropf auf die Körper. Das Kameratelefon, das nun (wieder mal) Bild und Wort miteinander konvergieren lässt. Und das Gespür für die Gegenwart verlieren lässt, so Rauterberg in den einleitenden Worten.
Ich las den Text mehrmals. Und halte ihn für einen medienkritischen Aufsatz (um nicht das große Wort „Essay“ zu benutzen), der bemerkenswert auf die gegenwärtigen medienkritischen Diskurse als auch die großen medientheoretischen Texte der Moderne und Postmoderne verweist. Wobei ich mir die Frage stellte, ob solch einen Text dann ebenso Teil des Kanons ist. Oder ob er in 50 oder 100 Jahren als eben solch ein kanonischer Text gelesen wird.
Wo ist also der Bezug zu den klassischen medienkritischen Essays? Wir haben es hier nicht mit einem neuen Medium zu tun. Darauf wird man noch lange warten müssen. Jedoch ist solch ein fotografisches Mobiltelefon symptomatisch für die Frühzeit (?) digitaler Medien. Im Gegensatz zu den klassischen Texten, die zu Beginn der großen Epochen des Rundfunks und des Fernsehens oder des Kinos um die Jahrhundertwende geschrieben wurden, haben wir es nicht mehr mit einem neuen Einzelmedium zu tun, das, um es mit Brecht auszudrücken, „auf eine vollkommen unvorbereitete Gesellschaft trifft“, sondern mit eben einem Produkt der eingangs beschriebenen Konvergenzstrategien.
Am Ende war das Wort und das Bild. So impliziert Rauterberg seinem Text das Paradigma vom „Ende der Geschichte“.
- “Weil uns das Gespür für Gegenwart entgleitet, für das, was im Hier und Jetzt liegt und wahrgenommen werden könnte, suchen wir Zuflucht im Dort und Damals, im Vorzeigbaren, zum Foto geronnen. Für einen Moment stellen wir die rasende Gegenwart still – wir halten etwas im Bilde fest, um uns selbst festzuhalten.“
Rauterberg erwähnt die Sixtinische Kapelle, die Akropolis, die großen und würdigen Familienfeste, bei denen es „aus allen Ecken blitzt“, das Auge, nicht mehr als Bildjäger vor der Linse, sondern ständig vor dem LCD-Bildschirm, der unsere Wahrnehmung strukturiert und der Hochzeitgesellschaft vorführt, was vor Beginn des feierlichen Essens Gegenwart war und im Moment des Aufnehmens schon zur Vergangenheit geronnen ist. Das Drücken des Auslösers bedeutet noch lange nicht die Fixierung des Dokumentierten. Das digitale Reproduzieren scheint mehr ein Gleiten mit der Kamera zu sein. Die Endfassung des Erfassten erfolgt am Computer. Der Bildausschnitt wird dort erst fixiert, „das Grass wird grüner, der Himmel wird blauer“
Das Hochzeitsfest im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Damit verweist Rauterberg auf Walter Benjamins großen Text, der zu Beginn der dreißiger Jahre den Verlust des Auratischen im medial reproduzierten Kunstwerk zugunsten einer zu schaffenden Ästhetik des Films beschrieb. Heute haben wir den Salat, will meinen den Verlust einer potentiell auratischen Gegenwart.
- „Könnte es Schöneres geben für einen, der süchtig ist nach Rückkopplung (dem Kontakt zu den ebenfalls mobilen Mitmenschen)? Der keinem Ort verhaftet ist und daher die Nähe in der Ferne sucht?“ (…) „Paradoxerweise wird dies Bedürfnis nach Anbindung gerade von der digitalen Fototechnik verstärkt, sie zertrümmert unser Gefühl für die Jetztzeit noch weiter.“
Rauterberg`s Referenzen auf den benjaminischen Kunstwerkaufsatz ordnen den Zeit-Artikel schon in eines der bestimmenden medientheoretischen Paradigmen ein. Der Verlust alles Auratischen, der in der technischen Reproduktion verhaftet ist heute so aktuell, wie zu Lebzeiten Benjamins. Prinzipiell hat sich nicht Vieles verändert. Nach wie vor begegnen wir Phänomenen, denen Originalität und Echtheit anhaften. Seien es Kunstwerke oder die zitierte Hochzeit. Es kommen jedoch strukturell andere Aspekte der Möglichkeit der Reproduktion hinzu. Es geht scheinbar nicht mehr allein um das technische Reproduzieren schlechthin, sondern um die Qualität und die „Ubiquität“ der Reproduktion. Allgegenwärtig ist sie. Strukturiert die Wahrnehmung der Welt und verändert diese nicht nur durch die bloße Reproduktion, sondern die dokumentierte Wirklichkeit an sich. Der Computer retuschiert und kaschiert, was nicht reproduziert werden soll. So ist jedes Bild eine Fälschung und hat keinen Anspruch mehr, die dokumentierte Gegenwart wiederzugeben.
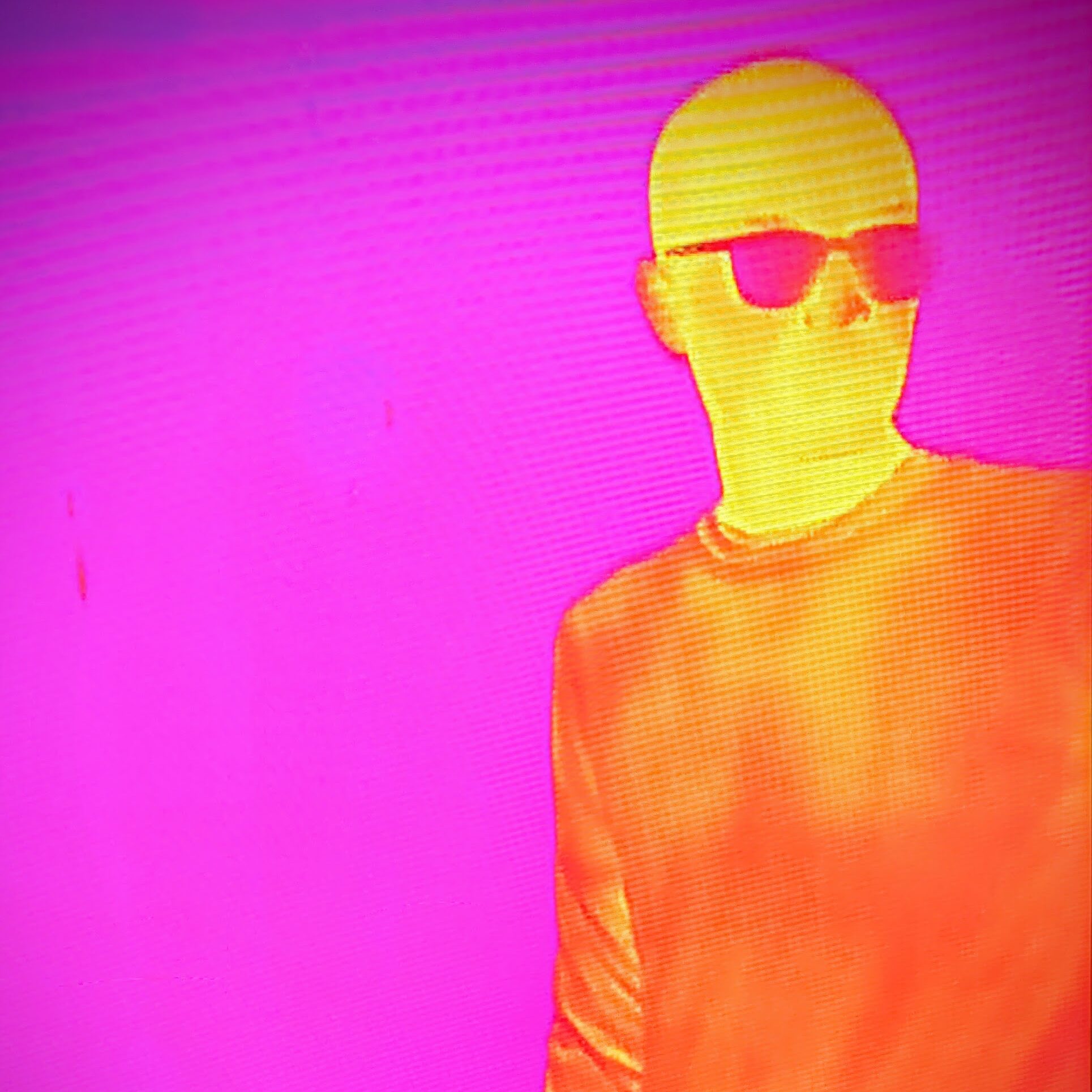
Eine Antwort
danke für die wochenendlektüre – damit meine ich auch deine kritik der kritik, die ich mir noch einmal genauer durchlesen muss.
falls dir am wochenende fad ist: eine schöne geschichte zum zwecklosen kampf gegen das rauschen im/durchs fernsehen: http://fm4.orf.at/grenzfurthner/103736/main
wer ist eigentlich rauterberg?