Nun bekomme ich also, was ich verlangt habe: Schreiben, und das nicht nur im Weblog, sondern bitte für ein massenhaftes Publikum. Zum Beispiel dem nicht näher bestimmten Rezipientenkreis der Medienseite der Frankfurter Rundschau. Nun stürze ich zunächst ins allgegenwärtige Sommerloch, dessen wunderbar lächerliche Geschichten vorwiegend die Bild schreibt: „Miles et Mores“ und kein Ende. Dies entsprechend zu kommentieren und bewerten obliegt für gewöhnlich den Ressortleitern.
Ich hingegen machte den Vorschlag, in der FR-Serie „Wildwuchs“, in der exotisch bemerkenswerte Printprodukte vorgestellt werden, die gute De:Bug zu portraitieren. Nun gut, man findet meinen Vorschlag sympathisch. Ich darf loslegen. Schreib aber – her mit der konstruktiven Kritik – ein wenig zu wissenschaftlich (ich wusste, das Studium ist eine Formalie) für jenes, nicht näher definiertes Publikum. Sollte versuchen, ein wenig deskriptiver und linearer zu formulieren, weniger verwunden. OK. Ein Glitzern in den Augen, als es hieß, dieser Stil, der sich nicht so arg leicht erschließt, könne vielleicht, freilich mit ein wenig zusätzlicher Bearbeitung, im Feuilleton stehen.
Ein Auszug aus der bisherigen Version, freigegeben zur Kritik der Online-Journalisten und zu eurem Vergnügen.
- Als Computer noch mit Lochkarten statt mit Prozessoren arbeiteten waren nicht Computerviren für fehlerhafte Operationen oder gar Programmabstürze verantworlich, sondern kleine Käfer, englisch „Bugs“, die ihren Hunger stillend, zu den vorhandenen Löchern weitere in die Karten fraßen.
Heute noch nennt man solche mit kleinen Fehlern behafteten Anwendungen „buggy“, auch wenn kein Krabbeltier, sondern nicht sauber geschriebener Quellcode den reibungslosen Programmablauf verhindert. Das anschließende Aufspüren und Ausmerzen fehlerhafter Programmzeilen nennt man „debugging“.
Ein Stück weit mag man den Titel der Monatszeitung „De:Bug“ als eine nostalgische Reminiszenz an die löchrigen Vorboten eines Lebens verstehen, das sich in mehr und mehr „elektronische Lebensaspekte“, so der Untertitel der in Berlin produzierten Zeitung, aufsplittet. Leicht zu akzeptieren ist diese These sicherlich nicht, bedeutet sie doch die Fragmentierung eines Ganzen in nicht fassbare und äußerst flüchtige Phänomene, die verschwunden sind sobald sie da sind. Halt. So gesehen wären elektronische Lebensaspekte in einer Tageszeitung nur sehr schwer zu beschreiben und viel Aufmerksamkeit würden Sie ihnen auch nicht schenken. Nähern wir uns den elektronischen Aspekten unserer Leben weniger mystisch und betrachte sie als Gesichtspunkte, die sich bereichernd in einer zunehmend medialen Alltagskultur bemerkbar machen.
Das würde vermutlich auch Jan Joswig, einer der sieben „De:Bug“-Redakteure ähnlich empfinden, für den elektronische Lebensaspekte mehr bedeuten, „als die Steckdose in der Wand.“ Und dieses Mehr schlägt sich in der thematischen Trias Musik, Medien und Kultur nieder, die überwiegend in elektronischen bzw. digitalen Kontexten verortet wird. Wer nun glaubt, die „De:Bugger“ sängen ein ähnliches Hohelied auf die neuen Medien wie die vielen marodierenden Unternehmen mit dem vorangestellten kleinen „e“ es einst anstimmten, der irrt sich. Zum einen dürften die Redakteure wohl nicht singen – vielmehr sind einige der Redakteure als DJs in den Clubs unseres Landes zu Gast–, zum anderen sieht sich die Redaktion vorwiegend als kritisch reflektierender Begleiter jener venture-capital finanzierten „e“-Entwicklungen.
„De:Bug“ blickt besorgt auf die großen Player, die die lukrative Plätze im Netz vereinnehmen und zu wenig Raum für das „Neue“ der neuen Medien lassen. Copyright, Filesharing, Open Source, Webradio sind redaktionelle Dauerläufer. Sind elektronische Lebensaspekte, die einen Paradigmenwechsel erfordern, der sich in der Gesellschaft beginnt durchzusetzen, in der Wirtschaft jedoch nicht akzeptabel ist. Doch in der Diskrepanz zwischen Idealismus und Realität sehen die Macher der „De:Bug“ keinen Grund zum (Netz)Kulturpessimismus. Zu beschreiben, „was möglich wäre“ sieht Jan Joswig als Ausweg aus dem Dilemma.
Mit solch einer Positionierung findet sich „De:Bug“ in guter netzkritischer Nachbarschaft. Wesensverwandt ist das Blatt mit dem amerikanischen Internet–Magazin „Wired“, das sich vorwiegend netztechnologogischen Themen hingibt und dem die musikalischen Lebensaspekte gänzlich fehlten. Rezensionen elektronischer Musik nehmen in der „De:Bug“ viel Raum ein. Allein in der August Ausgabe finden sich sage und schreibe 236 Kritiken schwarzer und silberner Scheiben. Wie gesagt: Da schreiben DJs – da legen Redakteure Platten auf. Mittlerweile ist diese ehemalige Nische gut besetzt. Die Auflage von rund 40.000 Exemplaren konnte trotz des Gangs zum Kiosk gehalten werden. Ein Zeichen von Loyalität der Leser, denn zuvor lag die Zeitung gratis in Berliner Cafes und Plattenläden aus. Nun kostet sie 2,80 Euro und Sascha Kösch, DJ und Buchhalter, bilanziert erstmals in schwarz. Gerade rechtzeitig zum fünften Geburtstag, den die Verlags-GmbH im Juli diesen Jahres mit einer Party im Berliner Kino International feierte. An den Plattentellern Buchhalter Kösch alias DJ Bleed. „Endlich stubenrein!“, freut sich die „De:Bug“ auf ihrer Webseite über sich selbst. A propos: Trotz konsequent digitaler Themen erscheint die „De:Bug“ in der klassichen Aufmachung einer Tageszeitung. Berliner Format, soviel Lokalkolorit sei erlaubt. Gründe dafür sieht Jan Joswig in der Tatsache, dass sich mit einer Internetausgabe kein Geld verdienen lässt. Zudem ist man am Kiosk ganz anders präsent. Dies liegt nicht zuletzt an der außergewöhnlichen Gestaltung des Blattes. Durchgehende Vierfarbigkeit sowie nicht auf Anhieb zu entschlüsselnde Bildfragmente (s. Abbildung) fordern die Auseinandersetzung mit Text und Bild. Layouter Jan Rikus Hillmann nimmt visuelle Formen, wie Vektor– oder Pixelgrafiken in das Blatt auf, die für Printprodukte vollkommen ungewöhnlich sind und eher dem Webdesigner geläufig sind.[…]
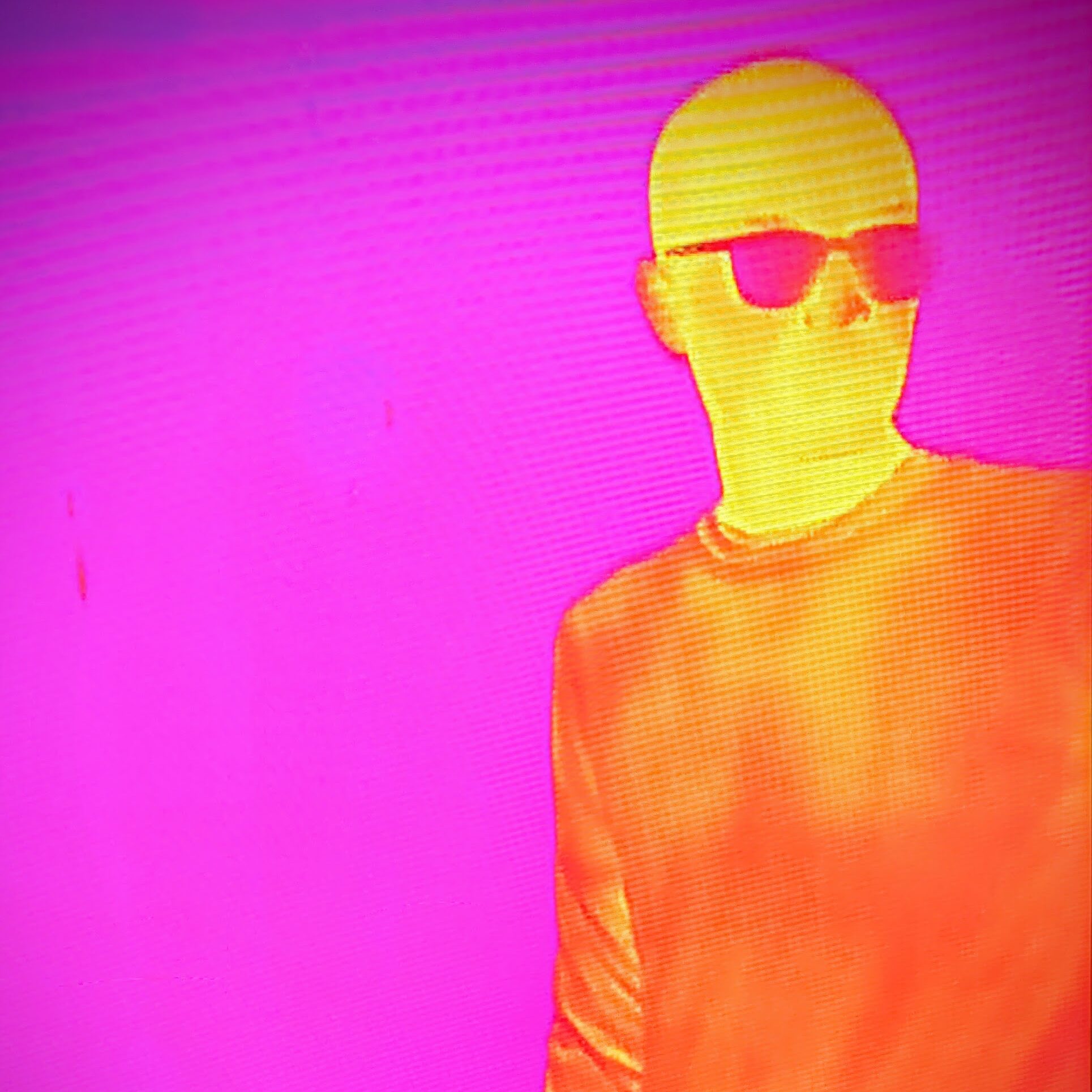
6 Antworten
Die Bug-Variante kannte ich noch nicht. Ich dachte immer, die Bezeichnung rühre daher, dass die damaligen Elektronengehirne noch Transistoren verwendeten, wie ältere Semester sie noch aus grünlich leuchtenden Röhrenradios kennen.
Und verendete in diesen Gebilden ein Käfer, so konnte dessen Leichnam schon mal zu einem Kurzschluss in den Transistorverdrahtungen führen; mit der Konsequenz einer fehlerhaften Ausführung des Programmcodes. „Debuggen“ bezeichnet somit dann das Entfernen dieser „Leichen“. Programmleichen gibt’s auch, aber jetzt schweife ich von diesem wunderbar morbiden Thema ab … Sorry!
Und weiterhin viel Spaß in Frankfurt!
überfliegenseindruck: ziemlich hypotaktischer aufbau, ich würde versuchen, etwas weniger einschübe und nebensätze zu verursachen und insgesamt kürzere varianten suchen.
mal ein hingewatzter versuch am ersten, gleich ziemlich langen satz:
Als Computer noch mit Lochkarten arbeiteten, waren nicht Computerviren für fehlerhafte Operationen und Programmabstürze verantwortlich. Es waren kleine, hungrige käfer, englisch „bugs“, die zusätzliche Löcher in die Karten fraßen.
naja. aber du weißt, was ich meine.
nochwas: do you know
http://glossy.antville.org ?
@ Andreas: Danke für den Hinweis und den Aufenthalt
@ Roland: habe hypotaktischer nachgeschlagen und glaube, dass es trifft. Hab ne neue Version geschrieben. Wenn sie erscheint…. mach ich ein Faß auf 🙂
Wenn das Fass in Frankfurt aufgemacht aufgemacht wird, bin ich gerne dabei 😉
Der Anfang ist ein wenig kryptisch, schwer zugänglich, aber dann liest es sich richtig locker und interessant. gefällt mir gut.