Während der Recherche für einen Beitrag in der kommenden Ausgabe der Navigationen wunderte ich mich darüber, dass neu auf den Markt kommende Medien so eine lange Phase der Orientierungs- oder besser, Inhaltslosigkeit durch machen müssen.
Man werfe dazu einen Blick zurück auf das junge Radio, das lediglich die Kopie älterer Medieninhalte war. Theater, Konzert oder Lokalzeitung – den Verkehrsfunk erfand man später.
Beim Fernsehen war es ähnlich. Spricht man über die modernen Massenmedien Radío und Fernsehen, so handelt es sich beim Rundfunk im Grunde um das erste jener Massenmedien. Beim Fernsehstart hätte man allerdings auf Basis der Erfahrungen reagieren können. Immerhin handelt es sich ebenso wie beim Radio um einen Rundfunkdienst.
Und was ist los im Internet? Sehen wir nicht überwiegend Inhalte (wenn überhaupt Inhalte), die irgendetwas entsprechen, nicht aber den Strukturen und Potentialen des Netzes.
Wieso ist das so? Ist es überhaupt so? Jedenfalls kann man über die Veränderung von Diskursen sprechen. Besser gesagt: Die Veränderung von Diskursen zitieren, denn so etwas stammt natürlich nicht aus meinem Köpfchen, sondern aus dem Vilem Flussers. Jedenfalls scheint es, als dass man, spricht man über das Netz, nicht bedacht hat, dass die Art des Diskurses, wie er in einem Medium abläuft, sich verändert.
Massenmedien wie Radio und TV bestehen aus Amphitheaterdiskursen. Diese Struktur besteht im wesentlichen aus zwei Elementen: Einem im Raum schwebenden Sender sowie den ausstrahlenden Kanälen, die die spezifischen Codes transportieren. Zeitungspapier, Hertzwellen oder Filmrollen. Die Empfänger sind vielzählig aber klein, ganz klein. Wie Satelliten sind sie um die Sender herum angeordnet. Organisatorisch befinden Sie sich am Rande, fast außerhalb des Diskurses. Sie sind gewissermaßen geeicht auf jeweils einen Kanal, der Informationen in den Sender pumpt. Dieses Modell ist eher totalitär. Es ist das Modell der Massenmedien.
Im Netz finden keine Diskurse statt, sondern Dialoge. Prototypen für Netzdialoge sind die Post und das Telefonsystem. Plauderei, Geschwätz oder Gerüchte gehören allerdings ebenso dazu. Wichtig erscheint mir Flussers Feststellung, dass Informationen nicht aus der Synthese von bereits vorhanden Informationen entstehen (wie es eben doch überwiegend der Fall ist – siehe These zu Beginn), sondern dass Informationen spontan durch die Verformung von Inhalten (z.B. durch Geräusche, durch das Netzgeflüster) entstehen. Das Ziel der Politik sollten Netzdialoge sein. Sie schaffen neue Informationen statt die alte Informationen redundant zu wiederholen, wie es beim Rundfunk geschieht, der so eine Veränderung des Menschen verhindert.
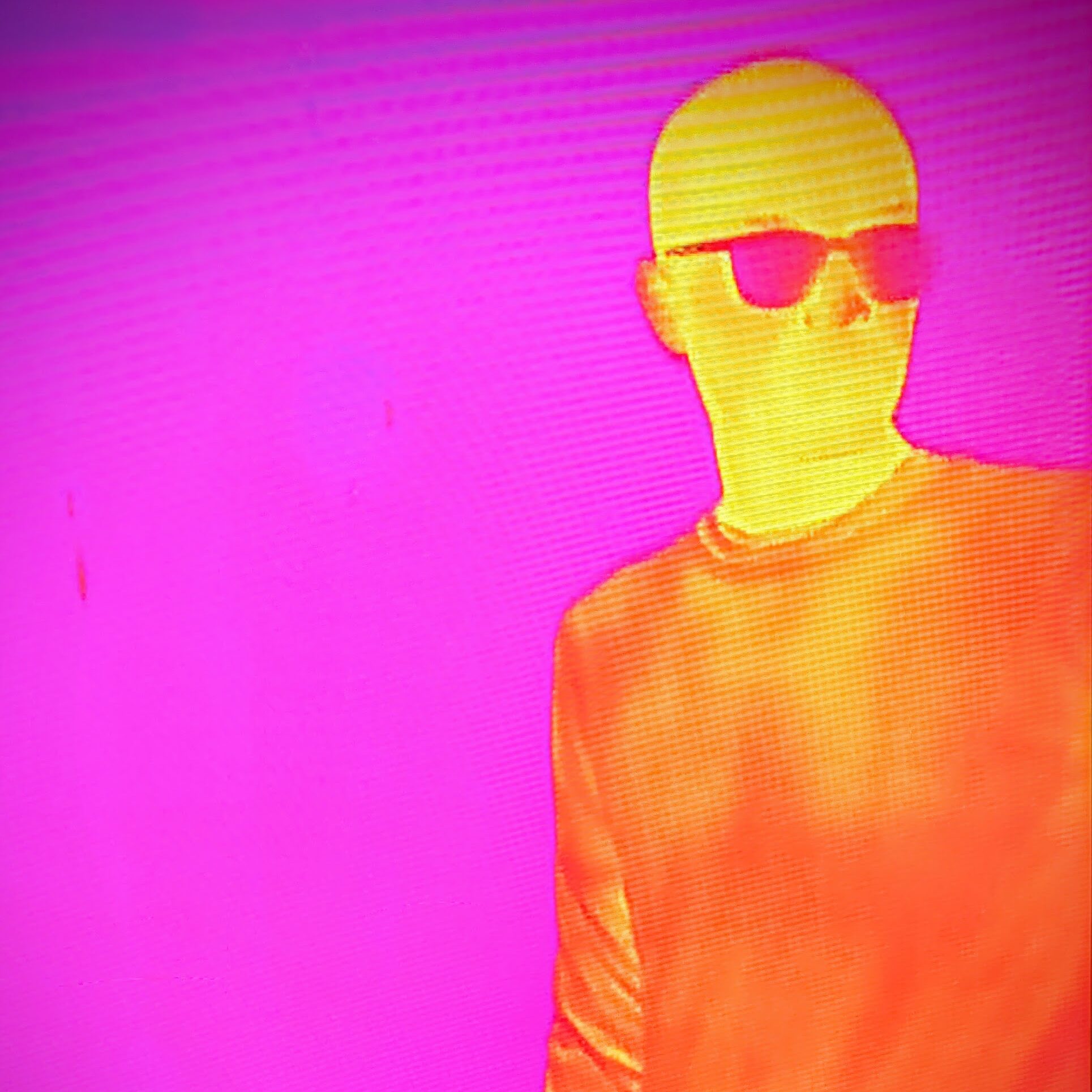
4 Antworten
zur orientierungsphase eines neuen mediums: war das nicht beim film ebenso? man hat theater bzw. theaterähnliche veranstaltungen abgefilmt, somit die totale/die guckkastenbühen als wahrnehmungsmodell herangezogen, bis man nach relativ langer zeit auf die idee kam man könne ja auch die kamera in bewegung bringen. der mensch ist scheinbar träger als man meint mit diesen ganzen „neuen“ medien.
Hi Ines, danke für den Hinweis. Ein paar solcher Gedanken sollen übrigens in dem Weblog Text für die Navigationen aufegnommen werden. Du hattest ja mal geschrieben. Hab ich nicht vergessen. Aber soetwas dauert halt…
Es gibt einen Weblog-Text in den neuen Navigationen? Henning, wir müssen uns nochmal offline unterhalten (will wissen, was unsere Herren Medientheoretiker zu diesem Thema gesagt haben).
Ja, den wird es geben. Wenn ich es mal schaffe, etwas zu Papier zu verbringen. Give me a call… obwohl, ist ja auch online