Ich rufe schon den ganzen Tag ins Radio, aber nix passiert. Schuld sind die beiden hier und ihre Debatte:
In ihrem Zentrum steht die Diskussion um die Funktion und Möglichkeit der technischen Massenmedien, vor allem Rundfunk und Fernsehen.
Enzensberger nimmt Ende der 60er Jahre in seinem „Baukasten zu einer Theorie der Medien“ die in Berthold Brechts Texten zum Rundfunk entstandenen Gedanken auf. Jean Baudrillard wiederum setzt sich Ende der 70er Jahre in weiten Teilen mit Enzensbergers Thesen auseinander. Obwohl die Autoren in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten argumentieren, beschäftigen sie sich alle mit der Frage, inwiefern technische Massenmedien wie Rundfunk und Fernsehen überhaupt als Kommunikationsapparate zu verstehen sind und warum ihre Realisierung in dieser Richtung bisher gescheitert sind. Brecht und Enzensberger vetreten dabei einen marxistischen- bzw. spätmarxistischen Ansatz, den Baudrillard Ende der 70er Jahre aufgibt.
Enzensberger würdigt die frühen marxistischen Autoren Brecht und Benjamin hinsichtlich ihres Bemühens, die Funktion der technischen Medien im Rahmen eines möglichen sozialistischen Gesellschaftsgefüges ausgewogen betrachtet zu haben und nicht, wie die Mehrzahl der Linken Ende der 60er Jahre, lediglich die repressive Funktion der Medien innerhalb eines kapitalistischen Systems wahrzunehmen. Enzensberger geht es vorderhand darum, die emanzipatorischen Möglichkeiten des Mediums zu entdecken. Eine neue Theoriebildung muß daher das theoretische Defizit der 60er Jahre aufarbeiten, das sich darauf beschränkt, die Massenmedien überwiegend mit dem Begriff der Manipulation gleichzusetzen.
Daß den Massenmedien die Manipulation immanent ist, steht für Enzensberger seit den Erfahrungen von 1968 außer Frage. Es wäre grundsätzlich falsch, von einer unmanipulierten Wirklichkeit auszugehen.
Hier nimmt Enzensberger die Botschaft Brechts auf, den Rundfunk als Distributionsapparat zu machen. Da dies die technische Funktionsweise des Rundfunkapparates erlaube, sind von vorherein festgelegte Sender-Empfänger Strukturen nicht inhärent und somit nicht zu akzeptieren. Es sind vielmehr die strukturellen Bedingungen der gesellschaftlichen Ordnung, die dies zulassen. Einen ersten Schritt macht man, indem man den Rundfunk nicht als Mittel der Manipulation, sondern als Produktionsmittel sieht. In der Folge kann jeder zum Sender werden. Das Wesen der Medien sieht Enzensberger grundsätzlich als egalitär, also auf gesellschaftliche Gerechtigkeit zielend, an.
Wenige Jahre später entsteht Baudrillars „Requiem für die Medien“, das versucht Enzensberger Bemühungen um eine Aufnahme der Medientheorie in eine marxistische Gesellschafttheorie zu entkraften. Baudrillard wirft den Marxisten vor, den reinen Kommunikationsprozeß, den Austausch, nicht ordentlich genug recherchiert zu haben. Dieser sei vollkommen unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen und rufe ein Verhältnis zwischen Sender und Empfänger hervor, das Kommunikation grundsätzlich unmöglich mache. Technische Medien basieren nach Baudrillard grundsätzlich auf Signalen, die auf ihre abstrakten Codes reduziert werden. Das Ereignis der Kommunikation wird so liquidiert und ein Tausch kann nicht mehr stattfinden. Die Realitäten (die zu kommunizierenden Ereignisse) werden auf Codes reduziert, die deren Unterscheidbarkeit unmöglich machen.
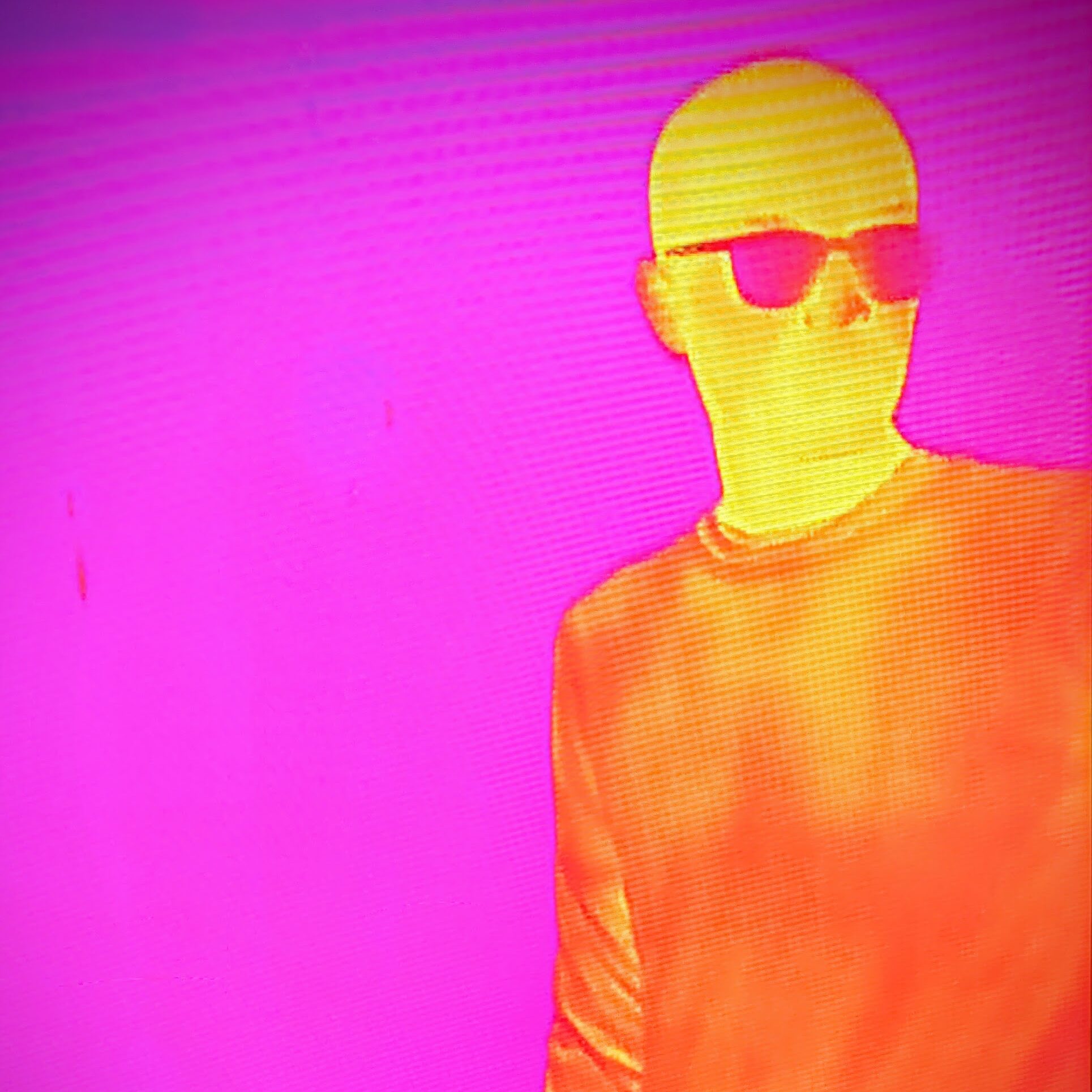
2 Antworten
an den autor:hey wer bist du?bin auf deine seite gestoßen weil ich morgen referieren muss an der uni. über kritische theorie, rundfunk. brecht, benjamin, enzensberger. beschäftigst du dich privat damit?y que haces en granada? da will ich zum auslandsstudium hin.
the message is the medium